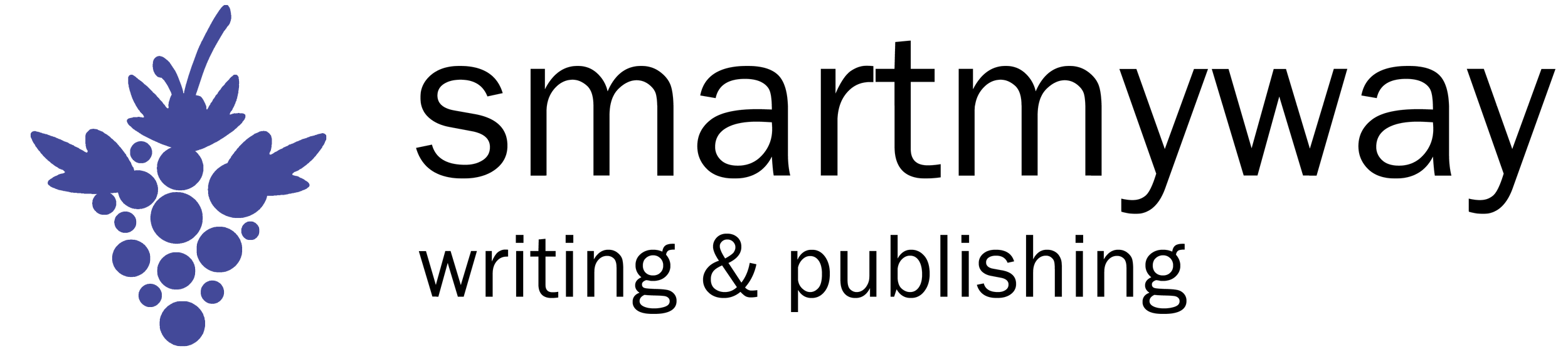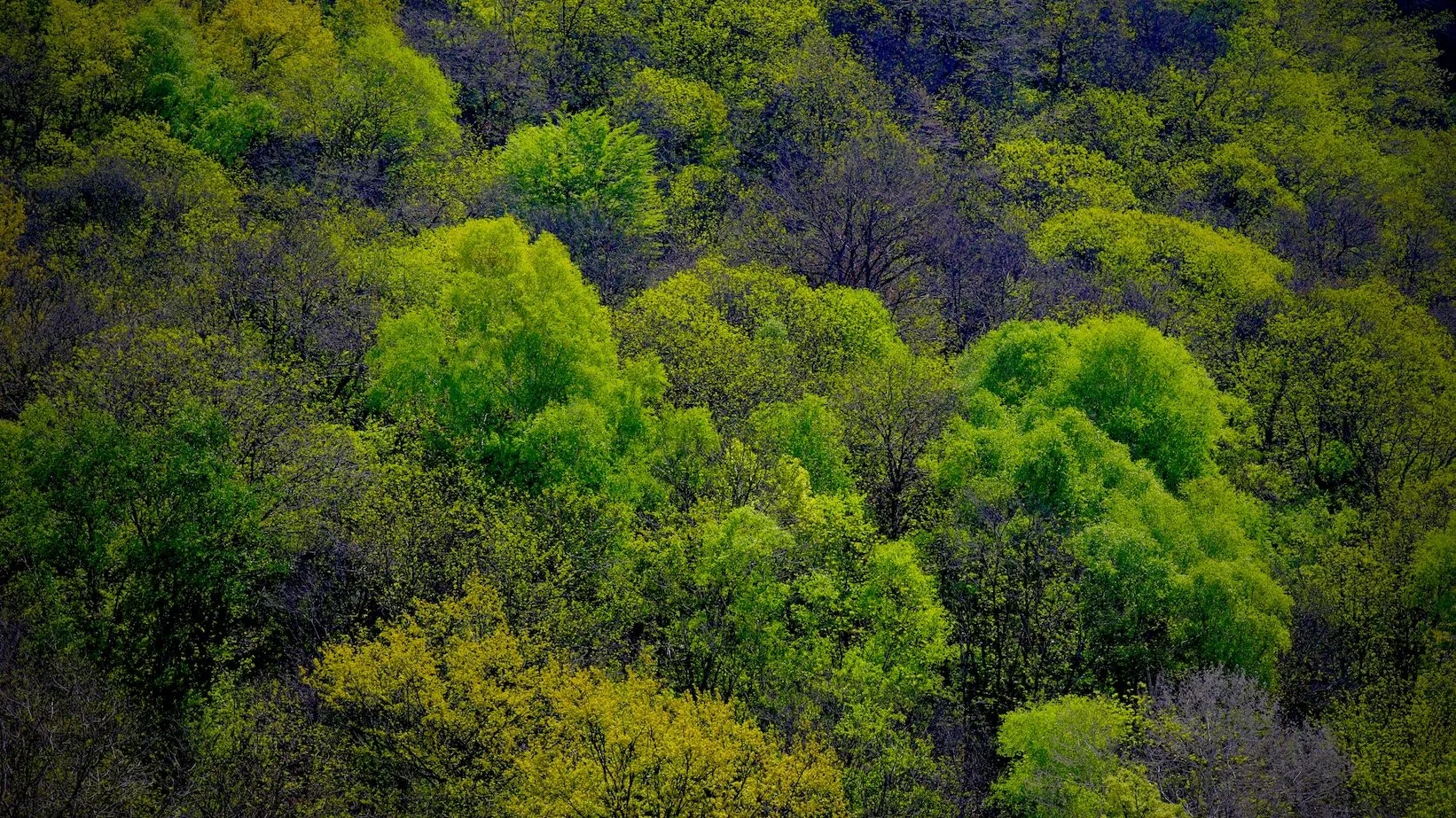Mehr EU bringt nicht mehr. Ausser mehr Risiken.

Das Paket Schweiz-EU ermöglicht künftig, dass EU-Recht für relevante Lebensbereiche direkt in der Schweiz gilt. Die EU steuert sektoriell die Handelsbeziehungen der Schweiz mit den EU-Mitgliedsländern. Hält sich die Schweiz nicht an die EU-Regeln, kann die EU sie sanktionieren. Das alles ist neu und heikel. Dabei wäre andernorts mehr Handlungsbedarf vorhanden.
Die Schweiz pflegt keine Handelsbeziehungen mit der EU. Sondern mit den Mitgliedsländern. In Summe sind die EU-Mitgliedsländer die wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Der EU-Binnenmarkt bietet dazu den Rahmen mit einem für die Marktteilnehmenden verbindlichen, umfangreichen Regelwerk.
Die USA, Deutschland, China, Italien und Grossbritannien sind die wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Diese Beziehungen sind die Grundlage für den Wohlstand unseres Landes. Die Interessenlagen sind nicht immer deckungsgleich und sie werden mit allen Mitteln vertreten. Das ist normal, und Belastungsproben sind für die Schweiz unausweichlich, wenn sie in dieser Wohlstandsliga mitspielen will. Egal, ob seitens der USA oder Deutschlands oder der EU. Der neuste Fall betrifft die USA mit ihrer willkürlichen Zollpolitik unter Donald Trump.
Wir stellen die Frage, ob das Paket Schweiz-EU die Schweiz tatsächlich weiterbringt.
Roland Voser 11. September 2025
Zur Rekapitulation.
Das Paket will die sektorielle Integration der Schweiz in den EU-Binnenmarkt.
Der Bundesrat präsentiert dem Souverän ein Paket Schweiz-EU unter dem Titel «Stabilisierung und Weiterentwicklung». Es folgt der Logik der Europäischen Union und will eine Integration der Schweiz in den Binnenmarkt, zumindest eine Assoziierung in einzelnen Sektoren.
Der Show-Stopper von 1992 und 2022 ist wieder da.
Das bedeutet eine partielle Übernahme von EU-Recht ohne Mitbestimmung. Dies steht im Gegensatz zu klassischen Freihandels- oder Kooperationsmodellen, wie das Freihandelsabkommen der Schweiz mit der EWG von 1972. Der EWR wurde 1992 vom Volk verworfen, weil es die Übernahme von EU-Recht ablehnte.
Aus exakt diesem Grund verwarf der Bundesrat 2022 das institutionelle Rahmenabkommen. Das vorliegende Paket Schweiz-EU beinhaltet diese Komponente erneut.
Die wichtigsten Handelspartner sind die wichtigsten Freunde.
Die seltsame Rolle der EU.
Die Schweiz verhandelt mit der EU über Regeln, wie sie mit den Mitgliedsländern Handel betreiben darf. Sie spricht nicht mit den Marktteilnehmenden in Berlin oder Rom, obwohl diese für die Beziehung zuständig sind.
Sie spricht mit Bürokraten, die keine reale Verantwortung tragen und doch die Regeln bestimmen. Geschäfte werden nicht in Brüssel getätigt, sondern in den Ländern. Das ist eigenartig, denn die demokratische Legitimation der EU-Regelgeber ist schwach. Viele von ihnen sind von den Mitgliedstaaten entsandte Funktionäre, deren Einfluss eher auf parteipolitischen Kräfteverhältnissen als auf direkter Bürgerwahl beruht.
Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz sind global und ausserhalb der EU.
Der beste Garant für Frieden ist ein prosperierender Handel. Die wirtschaftliche Leistung zeugt von der Güte und vom Erfolg. Die Fakten liefert das Bundesamt für Statistik. Die Export-Rangliste für 2024 präsentiert sich wie folgt (BfS): 1. USA, 2. Deutschland (Rang 1 der Schweizer Importe), 3. China, 4. Italien und auf dem Rang 5. Rang Grossbritannien.
Gesamthaft hat die Schweiz 2024 für 394 Milliarden CHF exportiert. Die 5 stärksten Länder stehen für 192.3 Milliarden der Schweizer Exporte und damit für knapp 50% der Schweizer Exporte.
Deutschland ist der wichtigste europäische Handelspartner der Schweiz.
Bei den Exporten Deutschlands ist die Schweiz auf 9. Rang zu finden (bei den Importen auf Rang 8). Deutschlands Aussenhandel ist stark europäisch geprägt. Im Folgenden die Export-Rangliste für 2024 von Deutschland (DESTATIS): 1. USA, 2. Frankreich, 3. Niederlande, 4. Polen und auf dem 5. Rang China.
Das Land Baden-Württemberg nimmt in Deutschland eine Sonderstellung ein. Die Schweiz ist mit rund 20 Milliarden Euro der zweitwichtigste Ausfuhrhandelspartner des Landes (gleicher Rang und gleiche Grössenordnung bei den Einfuhren). Baden-Württemberg ist bei den Schweizer Exporten mit Frankreich gleich auf (6. Rang der Schweizer Exporte). Die Nachbarregionen Bayern und Lombardei sind ebenfalls wichtige Export-Handelspartner der Schweiz.
Wieso akzeptiert die Schweiz die EU vorbehaltslos als Gate Keeper?
Ja, es ist klar: Die Mitgliedsländer haben der EU das Verhandlungsmandat erteilt. Das stellen wir nicht in Frage. Doch wir wundern uns und fragen: Was tut die Schweiz, was tut der Bundesrat, damit diese 5 wichtigsten Länder und 3 relevanten Regionen noch zufriedener mit der Schweiz sind?
Wie würden Sie Ihre besten Geschäftspartner behandeln? Etwa so, wie die Schweiz es heute tut?
Oder erinnern Sie sich an positive Meldungen über die Kooperation der Schweiz mit einem dieser 5 Länder oder 3 Nachbarregionen? Ausser dem Freihandelsabkommen mit China vielleicht? Gut, das war 2014 und ist schon einige Zeit her. Wieso sind die Handelspartner nicht im nötigen Bewusstsein der Schweiz?
Die Wirtschaftskraft Europas ist sehr unterschiedlich.
Die BIP-Leistungswerte aller Länder Europas sind ergänzt mit den USA, Kanada, China und Russland.
Um ein Bild zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Schweiz zu erhalten, stellt das BIP eine zweckmässige Orientierung dar. Es ist auch ein Orientierungspunkt für den Wohlstand eines Landes (siehe dazu auch «Was Sie sagen müssten, wenn Sie Bundesrat wären»).
Wir haben die Daten der Weltbank für alle europäischen Länder über den maximal verfügbaren Zeitraum herangezogen und mit den USA, China, Kanada und Russland ergänzt. Der Betrachtungszeitraum sind die Jahre 1960 bis 2024.
Ist sich die Schweiz ihrer Bedeutung bewusst?
Dazu haben wir auf den beiliegenden Grafiken die USA (blau), Deutschland (grün), China (gelb), Italien (violett), Grossbritannien (pink) und die Schweiz (rot) farblich markiert. Wir bieten Ihnen dazu drei Varianten an.
Im weltweiten Vergleich bleibt das nominale BIP von den USA dominiert, während China stark aufgeholt hat. In Europa führt Deutschland, die Schweiz liegt 2024 auf Rang 7. Beim BIP pro Kopf zeigt die Schweiz eine Spitzenleistung, ist jedoch wegen Volatilität und Abhängigkeit von Schlüsselbranchen wie Banking und Pharma anfälliger. Kaufkraftbereinigt rangieren die nordeuropäischen Länder am höchsten, die Schweiz behauptet sich solide. Wir verzichten auf weitere Ausführungen, Sie können sich ein eigenes Bild im Anhang machen.
Die Schweiz positioniert sich klug.
Bürgernähe macht den Unterschied.
Die Schweiz ist zweifellos ein ernstzunehmender Partner, möglicherweise ist sie sich dieser Stärke selbst zu wenig bewusst. Sie hat sich mit ihrem Erfolgskonzept der Bürgernähe (direkte Demokratie, Föderalismus, Neutralität) eine wirtschaftliche Position erarbeitet und über Jahrzehnte bewahrt.
Sie hat mit ihrem eigenständigen Weg ihren Wohlstand gesichert. Eigenständigkeit, die sich insbesondere in Eigenverantwortung und Agilität äussert, ist dabei der am Markt erfolgsentscheidende Faktor.
Freihandel ist das entscheidende Instrument.
Die Schweiz konnte dies in der Vergangenheit tun, weil sie ungebunden war und heute noch ist. Sie nutzte die Vorteile des Freihandels, ohne sich institutionell zu binden. Sie hatte aus diesem Grund 1992 den EWR-Beitritt verworfen und sich in der EFTA positioniert.
Das Paket Schweiz-EU stellt die Frage, ob die Schweiz ihrer bisherigen Linie treu bleibt oder ob sie sich in einen Prozess integrieren lässt, dessen Dynamik sie nicht mehr steuern kann.
Deutschland spielt in Europa eine Schlüsselrolle.
Anfang der 1990er-Jahre war der Wendepunkt für Europa.
Nach der wirtschaftlichen Betrachtung ist ein Blick in die Vergangenheit hilfreich, weil er den nötigen Hintergrund für ein engeres Zusammengehen mit der EU liefert. Die Jahre 1990-1992 zeigen mit der deutschen Wiedervereinigung, der Auflösung der UdSSR und des WAPA sowie der Gründung der politischen Europäischen Union (Maastricht) die Zeitenwende Europas.
Im Folgenden zeichnen wir für ein besseres Verständnis die nötige Entwicklung nach.
Versöhnung und Vernunft waren die Grundlage des deutschen Wirtschaftswunders.
Kaum ein anderer Nationalstaat hat Europas Geschichte der letzten hundert Jahre so stark bestimmt wie Deutschland. Es startete zwei Weltkriege und sorgte für die dunkelsten Stunden Europas. Nach 1945 brachten deutsche Persönlichkeiten wie Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Willy Brandt und Helmut Schmidt Vernunft und Versöhnung nach Europa.
Sie pflegten ein respektvoll-freundschaftliches Verhältnis zur Schweiz. Deutschland wurde zum Motor des wirtschaftlichen Wiederaufbaus des leidgeprüften Kontinents.
Die Schweiz schloss 1972 mit der damaligen EWG ein Freihandelsabkommen ab, das ihr den Marktzugang zum Binnenmarkt ermöglichte und ihr und ihren europäischen Handelspartnern eine erfolgreiche Zusammenarbeit ermöglichte, die bis heute anhält.
Maastricht wurde zum Wendepunkt.
Später war es Helmut Kohl, der entscheidend den Aufbau einer politischen Europäischen Union vorantrieb, die 1992 mit dem Vertrag von Maastricht besiegelt und mit der Euro-Einführung verankert wurde.
Damit änderte sich die Tonlage gegenüber der Schweiz. Während Deutschland europäische Integration und den Euro forcierte, blieb die Schweiz aussen vor und rückte damit ins Visier.
Politiker wie Oskar Lafontaine, Peer Steinbrück (2009 mit der Drohung, „die Kavallerie loszuschicken“), Wolfgang Schäuble oder Sigmar Gabriel setzten die Schweiz wegen ihres Bankgeheimnisses und ihrer Steuerpolitik scharf unter Druck. Die Schweiz gab diesem Druck letztlich nach.
Der Rettungsschirm war der Sündenfall.
2010 spielte Deutschland beim ersten Griechenland-Rettungspaket die Schlüsselrolle, das trotz der No-Bailout-Klausel im Maastricht-Vertrag beschlossen wurde. Es markierte den Beginn der Euro-Rettungsschirme sowie die faktische Aufweichung des Rechts.
Dieser Sündenfall relativierte Recht und Verträge, weil sie seither interpretiert und notfalls gebeugt werden können. Aktuellstes Beispiel ist der Schengen-Vertrag, der die Reisefreiheit garantiert.
Die Schweiz teilt diese Erfahrung, indem sie seitens der EU regelwidrig von Forschungsprogrammen wie Horizon und Erasmus ausgeschlossen (Medienmitteilung), durch den Entzug der Börsenäquivalenz sowie durch sektoriale Massnahmen im Bereich der Medizinprodukte und im Strommarkt unter Druck gesetzt wurde.
Aktuellstes Beispiel: Sämtliche Nachbarstaaten der Schweiz kontrollieren ihre Grenzen. Die Schweiz hält sich als einzige an die Vereinbarung von Schengen: Sie führt keine Grenzkontrollen durch.
Das ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert:
Erstens ist EU-Recht offensichtlich nicht (immer) verbindlich.
Zweitens hält sich die Schweiz unnötig an Regeln, die nicht mehr gelten oder noch nicht gelten.
Damit geht die Schweiz einen klassischen Wettbewerbsnachteil ein. Dieses Verhalten widerspricht klar der Bundesverfassung Artikel 5 Absatz 2 «Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.»
Merkels «wir schaffen das» blieb unerfüllt.
Deutschland setzte mit seiner Migrationspolitik und abrupten Systemwechseln wie dem Atomausstieg Entscheidungen durch, die Europa veränderten und auch die Schweiz direkt betrafen.
Diese Alleingänge zeigen exemplarisch, wie schnell Europa instabil werden kann, wenn zentrale Fragen ohne breite demokratische Grundlage entschieden werden.
Eine Zeitenwende von Versöhnung zu einem fragwürdigen Machtstreben?
Deutschland nimmt eine neue Führungsrolle ein. Zunächst wirtschaftlich fundiert, verändert das Land den Kontinent im Alleingang. Gleichzeitig tritt die EU auf dem globalen Parkett mit Machtanspruch auf, ohne die wirtschaftliche oder sicherheitspolitische Basis dafür zu haben. Dieses Machtstreben wirkt fragwürdig. Im Gegensatz dazu stand die frühere Politik der Versöhnung und Zusammenarbeit.
Die EU stösst an ihre Grenzen.
Der Bauplan für das Haus Europa fehlt.
Die EU verfolgt eine Expansion, die an ihre Grenzen stösst. Sie will weiterwachsen, obwohl es kein gemeinsames demokratisches Verständnis über die Zukunft im Haus Europa gibt.
Wir beobachten heute ein pointiertes Auftreten der europäischen Führung auf dem globalen Parkett, ohne dass sie effektiv Wirkung entfaltet. Dies im Gegensatz zur versöhnlichen Haltung mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit und verteidigungsorientierten Sicherheitskonzepten vor Maastricht. Zugleich nimmt in der EU die Schuldenlast zu, die Wirtschaft stockt und Instabilität wird sichtbar.
Das Wachstum der EU stösst offensichtlich an seine Grenzen. Die EU läuft Gefahr, Bürgernähe und Glaubwürdigkeit zu verlieren. Sie betreibt zwei Formen der Expansion, die das vernünftige Mass überschreiten. Der Brexit war das Resultat dieser Politik.
Es ist zuviel des Guten unter einem Dach.
Sie zeigt sich in der Aufnahme immer neuer Mitglieder mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Sie ist von sechs auf siebenundzwanzig Länder gewachsen und ein Ende ist nicht absehbar (Vision Olaf Scholz mit 36 Ländern). Sie versucht, unterschiedlichste Kulturen, Lebensentwürfe, Staatsformen und Entwicklungsstände unter einem Dach zu vereinen.
Diese expansive Integrationspolitik ist riskant, weil die kulturellen Unterschiede zu gross sind und damit die kritische Grösse überschritten wird.
Grossmachtstreben passt nicht zur Schweiz.
Sie umfasst die Vereinheitlichung und Zentralisierung einer Vielzahl von Politikfeldern, die über die ursprüngliche Idee einer Wirtschaftsgemeinschaft hinausgeht. Sie tut dies, ohne die bestehenden Bereiche ausreichend bewältigt zu haben.
Ein kleines Land wie die Schweiz benötigt nicht so viel Vereinheitlichung, sondern ist mit gelebter Eigenverantwortung erfolgreicher.
Die Schweiz sollte sich weiterhin zurückhalten.
Eine enge Anbindung der Schweiz an die EU zeigt mehr Risiken als Chancen.
Diese Mechanik der Angleichung und Einbindung wird im Paket Schweiz-EU offensichtlich. Sie wirkt direkt auf die Schweiz: dynamische Rechtsübernahme, zentrale Streitbeilegung sowie Retorsions-, Sanktions- oder Ausgleichsmassnahmen inklusive.
Eine Einbindung in ein System, das seine eigenen Überlastungen offenbart. Der Effekt ist klar: Die Wirtschaftskraft lässt nach. Der EU-Binnenmarkt kommt unter Druck. Der Ton wird härter. Auch gegenüber der Schweiz.
Das Paket Schweiz-EU bringt die Schweiz nicht weiter. Die Annahme, sie müsse sich in einen Binnenmarkt einfügen, ist falsch. Es geht auch ohne. Der Fokus sollte vielmehr unmittelbar auf die wichtigsten Handelspartner verschoben werden. Mehr EU bringt nicht mehr. Angesichts der aktuellen Konstellation innerhalb der EU befürchten wir eher das Gegenteil.
Wenn die Schweiz also Stabilität sucht, dann soll sie Chancen und Risiken vorsichtig abwägen. Geregelte Beziehungen mit der EU sind wünschenswert. Aber keine Integration, auch keine Teilintegration, wie es das Paket Schweiz-EU vorsieht. Unsere Mindestforderung bleibt unverändert: Wenn das Paket Schweiz-EU angenommen werden soll, dann gilt bei der Übernahme von EU-Recht für die Schweiz ein Veto ohne Wenn und Aber.
Stabilität ist mit gutnachbarschaftlicher Kooperation kraftvoll zu verstärken.
In Europa bedeutet Stabilität für die Schweiz nicht institutionelle Bindung, sondern gutnachbarschaftliche Kooperation. Die Frage wäre also: Was tut die Schweiz, um ihre Beziehungen mit den Nachbarländern und Nachbarregionen zu stärken?
Beispiele könnten sein:
Die Schweiz ermöglicht Zugang ins duale Bildungssystem der Schweiz für junge Menschen und Lehrbetriebe aus allen Nachbarregionen rund um die Schweiz.
Die Schweiz fördert den öffentlichen Verkehr für Grenzgänger.
Die Schweiz entwickelt mit Nachbarregionen Projekte für Erneuerbare Energien und Speicher, die beiden Seiten zugutekommen
Der Handlungsbedarf ist offensichtlich. Der Bundesrat ist aufgefordert, eine wirkungsvolle und erfolgsversprechende Aussen- und Handelspolitik einleiten und sich von der einseitigen Konzentration auf Brüssel zu verabschieden.
Denn das Zuhause gewinnt durch seine Nachbarn.
Anhang
Chronologie der Entwicklung der supranationalen Organisationen in Europa nach 1949.
Chronologie der Entwicklung der supranationalen Organisationen in Europa nach 1949 (Zusammenfassung).
Chronologie der Entwicklung der supranationalen Organisationen in Europa nach 1949 (Detailübersicht).
BIP Betrachtung aller europäischer Länder ergänzt mit den USA, Kanada, China und Russland
BIP nominal in US$
BIP/Kopf in US$
BIP/Kopf PPP in US$ (kaufkraftbereinigt)
Dieser Integrationsvertrag ändert zu viel.
Mit der Paket-Annahme würden 4388 Seiten EU-Gesetze direkt in der Schweiz gelten. Ohne Mitbestimmung. Die Verordnungen im Umfang von 86% gelten direkt ohne Abbildung in einem Schweizer Gesetz. Die Richtlinien werden mechanisch und direkt ins CH-Recht übersetzt.
(c) 2016: Schartihöreli, Kanton Uri, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Schweizsicht.
Die Sterne stehen für Tragweite, doch die Entscheidung fällt hier. Mit dem Paket Schweiz-EU steht unser Land vor einer existenziellen Zäsur. EU-Gesetze sollen gelten, ohne in einem Schweizer Gesetzbuch zu stehen. Ob wir das wollen, müssen wir selbst beurteilen. Die Regierung möchte es tun. Wir empfehlen es nicht. Die folgende Artikelserie liefert Ihnen die Begründung.
(c) 2017: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Die Schweiz in der Wachstumsfalle. Warum mehr vom Gleichen nicht reicht.
Das BIP pro Kopf hat sich seit 2006 nahezu verdoppelt, in den letzten zehn Jahren stagnierte aber das verfügbare Einkommen pro Kopf. Der Wohlstand der Schweiz wächst nicht im Portemonnaie der Menschen. Das ist nicht zukunftsfähig.
(c) 2016: Morcote, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Was Sie sagen müssten, wenn Sie Bundesrat wären.
Mit dem Paket Schweiz-EU will Brüssel gleiche Regeln für alle. Wenn Sie Bundesrat wären, müssten Sie erklären, dass dies für die Schweiz zwar Marktzugang und planbare Kooperation bringt, aber auch Rechtsübernahme ohne Mitbestimmung. Ihnen wird klar: Das ist eine Zäsur mit Folgen für Demokratie und Wohlstand.
(c) 2019: Monte Boglia, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Freizügigkeit ohne Kompass.
Die Schweiz funktioniert. Sehr gut sogar. Warum funktioniert das Paket Schweiz-EU aus unserer Sicht nicht überzeugend? Wir sagen: Erst das Ziel, dann die Regeln.
(c) 2023: Lago di Lugano, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Die Schweiz. Eine Utopie für Europa?
Mit dem Paket Schweiz-EU schlägt der Bundesrat einen Weg ein, der langfristig zur Anpassung ans europäische Mittelmass führen könnte. Dabei wäre das Gegenteil sinnvoll. Nicht die Schweiz sollte sich der EU angleichen. Europa sollte sich ein Beispiel an der Schweiz nehmen.
(c) 2023: Luganese, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Das Stromabkommen. Passt die Lösung zum Problem?
Das Stromabkommen aus dem Paket Schweiz-EU stellt Importgarantie und Souveränität zueinander ins Spannungsfeld. Nach der institutionellen Betrachtung prüfen wir, wie es aus Bürgersicht inhaltlich abschneidet. In unserem Fazit fragen wir uns, wie so eine Vorlage entstehen konnte.
(c) 2017: Lisone, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Dieses Paket bricht mit der direkten Demokratie.
Das Paket Schweiz-EU stellt die direkte Demokratie der Schweiz in Frage. Nach dem EWR-Nein und dem Abbruch des Rahmenabkommens soll mit dem Paket Schweiz-EU jetzt alles anders sein. Wir sehen das nicht so und sagen: Es reicht! Und wir erklären, warum.
(c) 2015: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Paket Schweiz-EU: Time-out bitte.
Die Vernehmlassung zum Paket Schweiz–EU ist angelaufen. Ein positives Zeichen, denn die Diskussionen sind engagiert und erzeugen Resonanz. Die institutionelle Anbindung rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen. Eine Klärung würde der Vernehmlassung gut tun. Der vorliegende Artikel liefert den Anstoss dazu.
(c) 2013: Monte Generoso, Capolage, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz.
Das Paket Schweiz-EU würde unser Land grundlegend und unwiderruflich verändern. Es geht um die Frage wer künftig unser Recht bestimmt, Brüssel oder wir. Zum 1. August 2025 mein Appell: Mischen Sie sich ein. Unsere Heimat gehört den Menschen nicht der Politik. Ein Blick auf die FDP zeigt warum.
(c) 2017: Capanna Monte Bar, Capriasca, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Das Stromabkommen im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit.
Das neue Stromabkommen (Elektrizität) im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit ist ein zentrales Element des Pakets Schweiz–EU. Es offenbart im Perspektivenwechsel ein unerwartetes Ausmass an gegenläufigen Erwartungen der Vertragspartner. Wer eintauchen will, dieser Artikel ist die richtige Gelegenheit dazu.
(c) 2019: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Orginalwortlaut Stromabkommen - hier online verfügbar.
Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? Wir haben die 163 Seiten des Stromabkommens ordentlich strukturiert und im Originalwortlaut der EU auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Wir leisten damit einen Beitrag zur Lesbarkeit dieses Abkommens. Wir hoffen, dass viele so einen einfacheren Zugang dazu finden und unser Angebot nützlich ist.
Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint.
Ein umfassendes Paket von Abkommen zur Festigung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt jetzt auf dem Tisch. Es bildet die Grundlage für eine folgenschwere Entscheidung der Schweiz, die es ernsthaft auszuloten gilt.
(c) 2025, Schloss Wildegg, Möriken-Wildegg, Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser.
Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.
Hier finden Sie die Stellungnahme von smartmyway zum Paket Schweiz-EU im Rahmen der offiziellen Vernehmlassung.
(c) 2016: Gewittersturm, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
smartmyway unterwegs.
(c) 2017: Lugano, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.
Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management