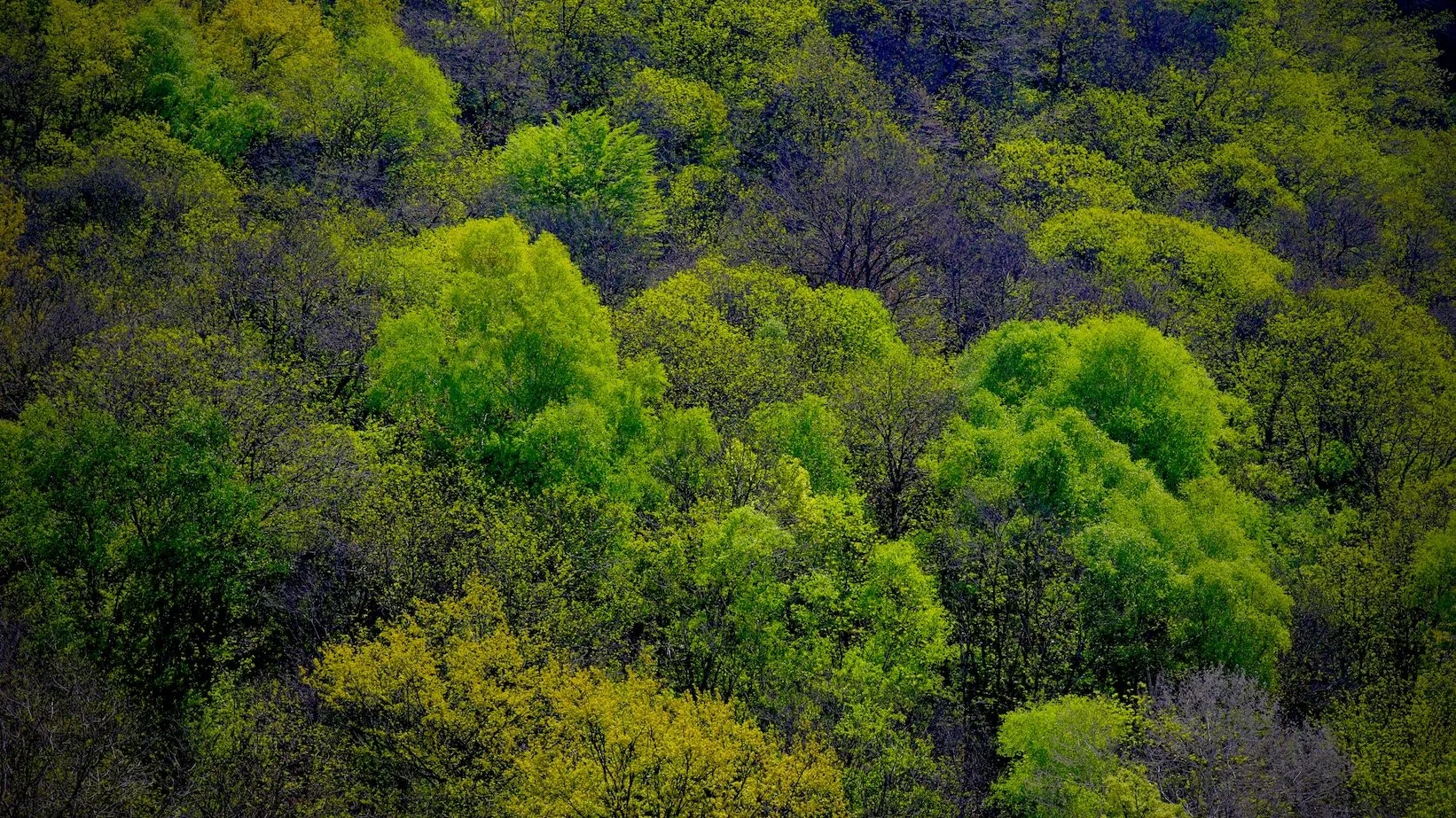Freizügigkeit ohne Kompass.

Die Schweiz funktioniert. Sehr gut sogar. Warum funktioniert das Paket Schweiz-EU aus unserer Sicht nicht überzeugend? Wir sagen: Erst das Ziel, dann die Regeln.
Die Personenfreizügigkeit ist wohl das heikelste Thema im Paket Schweiz-EU. Weil es emotional geladen ist. Letztlich sind immer Schicksale von Menschen damit verbunden.
Auch, weil dieses Abkommen kaum erfassbar ist. Es ist seit 2002 in Kraft, wurde mehrfach ergänzt und liegt heute in der Vernehmlassung nur als Änderungsprotokoll vor. Es gehört zudem zu den Abkommen, deren EU-Recht nach der Integrationsmethode direkt in der Schweiz gilt und damit tief in das rechtsstaatliche Verständnis der Schweiz eingreift.
Daher nähern wir uns dem Thema mit der folgenden Betrachtung. Wir stellen dar, wieso bereits das Grundsetting für dieses Abkommen falsch ist. Denn wer hat sich überlegt, welche Zuwanderung die Schweiz in den nächsten Jahren benötigt und warum? Doch zementiert das Abkommen einen Zustand, der nur aus der bisherigen Entwicklung sinnvoll erscheinen mag. Deshalb ist er fragwürdig.
Regierung und Politik erwarten von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie über dieses anspruchsvolle Thema abstimmen werden, ohne dass sie Expertinnen und Experten sind. Aus diesem Blickwinkel ist der folgende Artikel zu lesen: Im Rahmen der Vernehmlassung geben wir als Bürger und aus unserer Warte die gewünschte Rückmeldung an den Bundesrat.
Roland Voser, 18. August 2025
Hier finden Sie die Online-Quellen für folgende Themen: Vertragstext Freizügigkeitsabkommen, Vertragstext Stromabkommen, Lesehilfe EDA-Dokumente
Lesen Sie auch unsere Analyse zum Stromabkommen aus institutioneller Sicht (Link) und die Detailbetrachtung der institutionellen Elemente (Link).
Wenn das eigene Hemd am nächsten ist.
Letztlich geht es um Vorteile. Auch beim Paket Schweiz-EU ist es nicht anders. Wir als Verlag hätten Vorteile, wenn wir unsere Bücher europaweit ohne Hürden versenden könnten, wenn wir keine zusätzliche EU-konforme Mehrwertsteuerabrechnung erstellen müssten, wenn wir nicht die rigiden und komplizierten EU-Datenschutzverordnungen mit ihren unabsehbaren Konsequenzen bei Nichtbefolgung einhalten müssten und wenn wir auf einen Datenschutzbeauftragten in der EU verzichten könnten.
Dann sähe die Diskussion für uns anders aus. In diesem Fall würden die EU-Vorschriften nicht faktisch die Geschäftstätigkeit unseres kleinen Verlags in der EU verhindern.
Vielleicht würden wir sagen, was soll’s, nehmen wir dieses Paket an und kümmern uns um unser Geschäft. Es wäre ein legitimer Gedanke, denn die konkrete Wertschöpfung von Unternehmen ist die einzig wirklich unverzichtbare Voraussetzung für den Wohlstand eines Landes.
Doch wir haben diese Vorteile nicht. Wir haben uns das Paket näher angeschaut und die öffentliche Diskussion mitverfolgt. Rasch wurde klar: Es gibt die beiden Lager der Befürworter und Kritiker bereits ausgeprägt. Dies, obwohl erst die Vernehmlassung läuft und die Abstimmung wohl erst in zwei Jahren stattfinden wird.
Wir erkennen zwei Grundhaltungen, die sich nicht einfach Parteien zuordnen lassen, sondern über die ganze Gesellschaft verlaufen. Eine Person kann je nach Situation beide Haltungen einnehmen. Die Menschen legen oft ein opportunistisches Verhalten an den Tag.
Die einen suchen Sicherheit in der Diversität, also Vielfalt. Sie fühlen sich global zugehörig, glauben an Gerechtigkeit durch Gleichbehandlung, vertrauen Institutionen und sind emotional mit Europa und der Welt verbunden.
Die anderen suchen Sicherheit in der eigenen Identität, der Orientierung. Sie fühlen sich lokal verwurzelt, glauben an Gerechtigkeit durch Leistung, vertrauen Eigenverantwortung und sind emotional mit der Schweiz verbunden.
Die Personenfreizügigkeit stösst bei Befürwortern auf breite Zustimmung.
Im Kontext der Personenfreizügigkeit ist dieses Spannungsfeld besonders wirksam. Das Freizügigkeitsabkommen regelt Aufenthalt und Arbeitsaufnahme, den Familiennachzug und die Koordination der sozialen Sicherheit sowie flankierende Bereiche wie vorübergehende Arbeitseinsätze aus dem Ausland und grenzüberschreitende Dienstleistungen.
Die Befürworter werden dies unterstützen, weil ihnen die völkerverbindende Logik von Brüssel näher liegt. Sie sehen über die damit einhergehende nahezu unüberblickbare und unkontrollierbare Bürokratie hinweg. Es ist ein Übel, das in Kauf genommen wird, um im Gegenzug eine Vision einer europäischen Gemeinschaft zu verwirklichen. Hinzu kommen handfeste Vorteile, allen voran der diskriminierungsfreie Zugang zum europäischen Binnenmarkt.
Die Kritiker sehen in der Personenfreizügigkeit Identität und Wohlstand gefährdet.
Es sind Vorteile, die jedoch den weiten Vorsprung der Schweiz beim Wohlstand gegenüber ihren Nachbarn nicht erklären können. Die Schweiz weist ein rund doppelt so hohes BIP pro Kopf wie ihre unmittelbaren Nachbarn Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien aus.
Wir haben die Begründung dazu in unserem letzten Artikel «Die Schweiz. Eine Utopie für Europa.» hergeleitet. Wir meinen, dass die Ursache in dem liegt, was die Schweiz anders macht als ihre Nachbarn. Daraus folgt eine wenig überraschende logische Schlussfolgerung: Direkte Demokratie, Neutralität und Föderalismus sind das Fundament des Erfolgs der Schweiz.
Damit schliesst sich der Kreis zu den Kritikern, die eine Angleichung an die EU als kontraproduktiv erachten, weil dadurch die Identität und die Erfolgsfaktoren der Schweiz untergraben werden können.
Dieser Standpunkt kommt nicht von ungefähr. Denn auch das Personenfreizügigkeitsabkommen übernimmt 746 Seiten EU-Recht, das nach einer Annahme des Pakets direkt in der Schweiz gelten würde, ohne dass es in Schweizer Gesetzen auffindbar wäre.
Zum Vergleich: Kein Schweizer Gesetzbuch weist unseres Wissens diesen Umfang auf (Bundesverfassung 102 Seiten, Obligationsrecht 556 Seiten, Strafgesetzbuch 196 Seiten, Strafprozessordnung 180 Seiten, Zivilgesetzbuch 388 Seiten, Zivilprozessordnung 136 Seiten).
Es sind zwei unversöhnliche Lager entstanden.
Die beiden Grundhaltungen haben in der EU-Frage in den letzten 40 Jahren zu zwei nahezu unversöhnlichen Lagern geführt. Auf diese Patt-Situation reagieren Politik und Verwaltung so: Entscheide werden so lange dem Volk vorgelegt, bis es Ja sagt.
Dieses Vorgehen entzieht der Demokratie jedoch letztlich die konstruktive Arbeitsgrundlage und führt zu Blockaden und Stillstand. Es ist das, was wir auch beobachten. Sind in einem Unternehmen die Teilhaber derart unterschiedlicher Meinung, führt das konsequenterweise zur Trennung. Das zeigt die Dramatik der Situation.
So steht die Schweiz im Grunde zerrissen der EU gegenüber und hat in diesem politischen Klima ein Paket verhandelt. Doch in welchem Sinn und Geist dies geschah, wissen wir nicht. Es liegt nahe, dass daraus eine defensive Verhandlungsposition entstanden ist.
Das ist für die EU sehr vorteilhaft. Und zwar aus zwei Gründen. Sie kann der Schweiz mit der Integration eine «Lösung» für ihre unüberbrückbare Meinungsverschiedenheit in dieser Sache anbieten und zugleich ihr Grundanliegen, die Harmonisierung des Binnenmarktes, ein entscheidendes Stück weiterbringen.
Es ist ein gutes Paket. Für Brüssel.
Daraus ergibt sich der vordergründige Zweck des Pakets: «Eine bessere Integration der Schweiz in den Binnenmarkt». Doch dieser Zweck darf nicht täuschen. Denn zwischen Vertragsparteien sind unterschiedliche Interessenlagen die Regel, so auch hier:
Für die EU ist entscheidend, dass die Schweiz keine Standortvorteile etabliert oder halten kann, die die Wettbewerbsfähigkeit der EU unterlaufen. So etwa beim Zugang zu Patientendaten für die Forschung: Hat die Schweiz ein weniger strenges Datenschutzregime, dann werden sich Firmen eher in der Schweiz ansiedeln als in der EU.
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Schweiz kein EU-Mitglied ist. Die im Paket versprochene Stabilität verlangt im Gegenzug Steuerungsrechte, und daraus ergibt sich eine verstärkte Abhängigkeit der Schweiz von der EU.
Erfolgt das Ganze ohne Mitbestimmung, wie beim vorliegenden Paket, dann fällt auch der Gestaltungswille weg. Wo Wille fehlt, da fehlt Motivation und damit der Antrieb zum eigenen Erfolg. Ein Absinken in die Mittelmässigkeit ist absehbar.
Die Agilität der Schweiz ist letztlich erfolgsentscheidend.
Wir wiederholen es: Die drei Säulen des Schweizer Erfolgsmodells sind direkte Demokratie, Neutralität und Föderalismus. Sie sind Fundament und Voraussetzung jedes Standortvorteils der Schweiz. Die Wettbewerbsfähigkeit ist das Ergebnis daraus.
Das Paket Schweiz-EU integriert die Schweiz faktisch in die EU, ohne Mitbestimmung. Die Schweiz wird so schlechter gestellt als der Rest der EU. Als Perspektive egalisiert das Paket heutige Wettbewerbsvorteile und bietet im Gegenzug planbare Mittelmässigkeit.
Wieso soll die Schweiz dafür ihr Recht derart aufblasen? Die Schweiz verliert nicht nur bedeutende Teile ihrer Identität, sondern ihr wichtigstes Gut, ihre Agilität.
Trump und seine Zölle werden verschwinden. Dieses Paket und seine kaum überschaubaren Regulierungen bleiben. Praktisch unumkehrbar. Das Paket ist daher für die Schweizer Wirtschaft mindestens so nachteilig, wie es einzelnen Branchen und Unternehmen nützen könnte.
Ein schlechter Deal lohnt nicht. Er ist uninspiriert und visionslos.
Dafür soll sich die Schweiz an die EU angleichen? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil. Die EU sollte sich, wo immer möglich, an der erfolgreichen Schweizer Ordnung orientieren. Es wäre eine grosse Chance für die EU.
Das Paket Schweiz-EU ist daher eher rückwärtsgewandt, weil es lediglich mehr vom Bekannten enthält und dieses mit wirkungsvolleren EU-Vorgaben unverrückbar verankert.
Doch was ist das Zielbild der Schweiz für das Jahr 2050? Wie sähe eine Entwicklung aus, die den sozialen Zusammenhalt, die Stabilität der Gesellschaft und eine umweltverträgliche Lebensqualität anstrebt? Was ist die Vision der Schweiz für ihre Zukunft? Was sind die Eckpfeiler und Prinzipien für die Personenfreizügigkeit?
Bezogen auf dieses Thema: Werden nach wie vor Fachkräfte benötigt, oder wie verändern Digitalisierung, KI und Robotik nicht nur den Bedarf an Zuwanderung, sondern die ganze Gesellschaftsstruktur? Oder weshalb könnte die Schweiz im Extremfall zum Auswanderungsland werden?
Ja, das wären die Fragen, die vor einem solchen Paket zuerst zu beantworten und über die eine Einigkeit herzustellen wäre. Doch der Bundesrat geht in dieser zentralen Frage den Weg des geringsten Widerstands, weil das Land uneinig ist und ein gemeinsames Verständnis für die Zukunft fehlt. Das Vorgehen nach dem Konzept des kleinsten gemeinsamen Nenners wirkt ideenlos und reaktiv.
Das Abkommen scheitert an seiner kurzfristigen Optik und fehlenden langfristigen Perspektive.
Das Paket Schweiz-EU läuft Gefahr, Vorteile nur wenigen zu bringen. Der Preis wäre jedoch Steuerungsverlust für alle.
Wir sagen: Kooperation ja, mit nationalem Opt-out vor Sanktionen («Veto ohne Wenn und Aber») und ohne letztverbindliche Entscheidungen des EuGH bei Konflikten. Das Paket hat eine kurzfristige Optik. Seine Folgen sind jedoch langfristig und nahezu unumkehrbar.
Stattdessen braucht es eine Grundsatzdiskussion in der Schweiz, die die drei Elefanten im Raum benennt und dabei die Gesellschaftspfeiler direkte Demokratie, Neutralität und Föderalismus vorbehaltlos respektiert.
Ein Zielbild Schweiz 2050 fehlt. Damit ist unbeantwortet, welche Zuwanderung die Schweiz zukünftig braucht.
Knappe Mehrheiten spalten statt zu einen. Das ist langfristig für das Land kontraproduktiv.
Das gegenseitige Vertrauen erodiert. Das Vertrauensverhältnis zwischen den Lagern und der Regierung ist angespannt. Versöhnung ist erschwert und Entscheide verlieren ihre bindende Wirkung.
Das Freizügigkeitsabkommen sollte die innere Entfremdung stoppen, nicht forcieren.
Solange kein gemeinsames Zielbild existiert, trägt die Personenfreizügigkeit heute in der Schweiz strukturell zur inneren Entfremdung bei. Nötig ist ein Schweizer Rahmen, der zuerst die Richtung klärt, dann die Steuerung sichert und erst danach die Kooperation mit Dritten konkretisiert. Personenfreizügigkeit darf Mittel sein. Sie ist kein Selbstzweck.
So gesehen ist das Paket Schweiz-EU zu einer von Etablierten gemachten und gewollten Sammlung von Abkommen geworden, die den Status quo absichert. Die Jungen als Vertreter der kommenden Generationen konnten zum nötigen Zielbild nicht beitragen und bleiben in der Diskussion ausgeschlossen. Das ist aufgrund von Unumkehrbarkeit und Tragweite der problematischste Aspekt.
Personenfreizügigkeit braucht einen Kompass und Einigkeit darüber. Erst das Ziel, dann die Regeln. Erst die Schweiz, dann Europa. Zuerst das Zielbild klären. Danach verhandeln.
Die Schweiz. Eine Utopie für Europa?
Mit dem Paket Schweiz-EU schlägt der Bundesrat einen Weg ein, der langfristig zur Anpassung ans europäische Mittelmass führen könnte. Dabei wäre das Gegenteil sinnvoll. Nicht die Schweiz sollte sich der EU angleichen. Europa sollte sich ein Beispiel an der Schweiz nehmen.
(c) 2023: Luganese, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Das Stromabkommen. Passt die Lösung zum Problem?
Das Stromabkommen aus dem Paket Schweiz-EU stellt Importgarantie und Souveränität zueinander ins Spannungsfeld. Nach der institutionellen Betrachtung prüfen wir, wie es aus Bürgersicht inhaltlich abschneidet. In unserem Fazit fragen wir uns, wie so eine Vorlage entstehen konnte.
(c) 2017: Lisone, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Dieses Paket bricht mit der direkten Demokratie.
Das Paket Schweiz-EU stellt die direkte Demokratie der Schweiz in Frage. Nach dem EWR-Nein und dem Abbruch des Rahmenabkommens soll mit dem Paket Schweiz-EU jetzt alles anders sein. Wir sehen das nicht so und sagen: Es reicht! Und wir erklären, warum.
(c) 2015: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Paket Schweiz-EU: Time-out bitte.
Die Vernehmlassung zum Paket Schweiz–EU ist angelaufen. Ein positives Zeichen, denn die Diskussionen sind engagiert und erzeugen Resonanz. Die institutionelle Anbindung rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen. Eine Klärung würde der Vernehmlassung gut tun. Der vorliegende Artikel liefert den Anstoss dazu.
(c) 2013: Monte Generoso, Capolage, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz.
Das Paket Schweiz-EU würde unser Land grundlegend und unwiderruflich verändern. Es geht um die Frage wer künftig unser Recht bestimmt, Brüssel oder wir. Zum 1. August 2025 mein Appell: Mischen Sie sich ein. Unsere Heimat gehört den Menschen nicht der Politik. Ein Blick auf die FDP zeigt warum.
(c) 2017: Capanna Monte Bar, Capriasca, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Das Stromabkommen im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit.
Das neue Stromabkommen (Elektrizität) im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit ist ein zentrales Element des Pakets Schweiz–EU. Es offenbart im Perspektivenwechsel ein unerwartetes Ausmass an gegenläufigen Erwartungen der Vertragspartner. Wer eintauchen will, dieser Artikel ist die richtige Gelegenheit dazu.
(c) 2019: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Orginalwortlaut Stromabkommen - hier online verfügbar.
Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? Wir haben die 163 Seiten des Stromabkommens ordentlich strukturiert und im Originalwortlaut der EU auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Wir leisten damit einen Beitrag zur Lesbarkeit dieses Abkommens. Wir hoffen, dass viele so einen einfacheren Zugang dazu finden und unser Angebot nützlich ist.
Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint.
Ein umfassendes Paket von Abkommen zur Festigung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt jetzt auf dem Tisch. Es bildet die Grundlage für eine folgenschwere Entscheidung der Schweiz, die es ernsthaft auszuloten gilt.
(c) 2025, Schloss Wildegg, Möriken-Wildegg, Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser.
Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.
Hier finden Sie die Stellungnahme von smartmyway zum Paket Schweiz-EU im Rahmen der offiziellen Vernehmlassung.
(c) 2016: Gewittersturm, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
smartmyway unterwegs.
(c) 2023: Lago di Lugano, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.
Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management