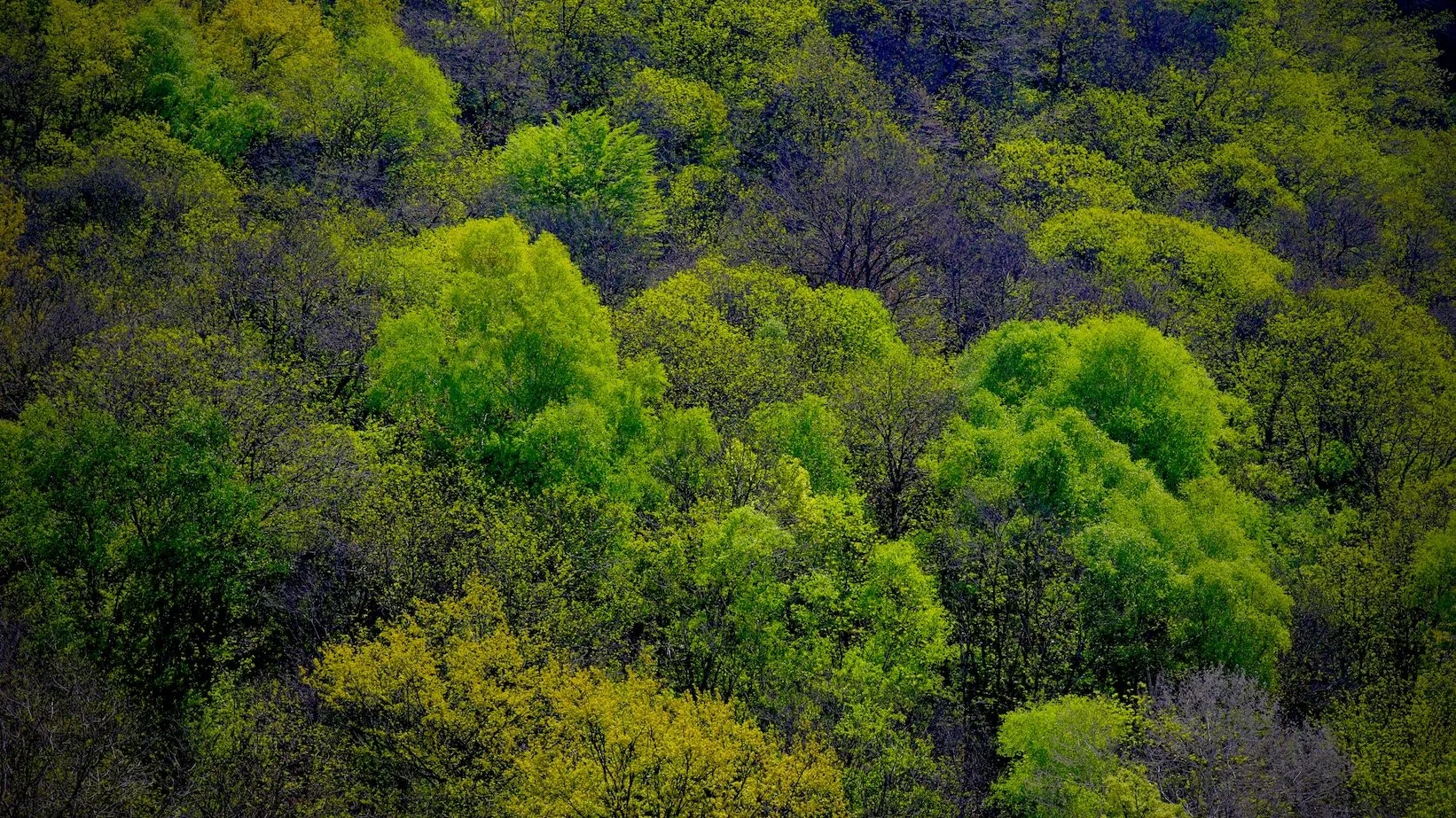Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz.

Das Paket Schweiz-EU würde unser Land grundlegend und unwiderruflich verändern. Es geht um die Frage wer künftig unser Recht bestimmt, Brüssel oder wir. Zum 1. August 2025 unser Appell: Mischen Sie sich ein. Unsere Heimat gehört den Menschen, nicht der Politik. Ein Blick auf die FDP zeigt warum.
Das Paket Schweiz-EU ist nicht nur eine juristische Vereinbarung, nicht bloss ein technisches Vertragsbündel, das routinemässig technische Normierungen zwischen der Schweiz und der EU vereinfacht. Es ist vielmehr ein Paket ausgewachsener Staatsverträge, eine substantielle Weiterentwicklung der Bilateralen I und II, die sich aber in einem Punkt massgeblich unterscheidet: Die institutionelle Anbindung wirkt für die Schweiz in den entscheidenden Bereichen Freizügigkeit, Strom, Lebensmittelsicherheit, Luftverkehr und Gesundheit faktisch wie ein EU-Beitritt, jedoch ohne Mitbestimmung. Die Schweiz wird zum Passivmitglied, aber mit entscheidenden Pflichten. Neu ist die strategischer Bedeutung. Das Paket transferiert in den 4 zentralen Dossiers die massgebliche Kontrolle über Versorgungssicherheit und innere Stabilität sowie die nationale Markthoheit der Schweiz an die EU.
Letztlich steuert so die EU den zukünftigen Wohlstand der Schweiz. Das Paket wird damit logischerweise zu einer politischen Zerreissprobe für die Schweiz. Über alle Parteigrenzen hinweg, durch alle Bevölkerungsschichten hindurch, in allen Landesteilen. Während die einen die Verträge als «verhandelt» erklären und rasch die Umsetzung ins Zentrum stellen, beginnen andere erst zu begreifen, was auf dem Spiel steht: Dieses Land droht sich selbst zu entmachten. Und niemand will es am Schluss gewesen sein. Die FDP spielt darin eine zweifelhafte Rolle und droht daran zu zerbrechen. Erste Risse sind sichtbar. Lassen Sie sie uns kitten und die nötige Debatte starten.
Roland Voser, 24. Juli 2025, zum 1. August 2025, dem Nationalfeiertag der Schweiz.
Hier lesen Sie die italienische Übersetzung (Link).
Prolog.
Seit der Bundesrat am 13. Juni 2025 die Vernehmlassung zum Paket Schweiz-EU eröffnet hat, ist etwas ins Rutschen geraten. Die politische Diskussion ist gekippt. Die Debatte zum Paket dreht sich nicht mehr um einzelne Detailfragen, sondern um die Grundausrichtung der Schweiz. Plötzlich ist das Selbstverständnis dieses Landes ins Zentrum gerückt. Also das «Sein oder Nichtsein» ist hier die Frage. Dies, obwohl gerade diesen Kelch offensichtlich alle scheuen wie der Teufel das Weihwasser und hoffen, dass er an ihnen vorbei geht.
So erleben wir statt einer offenen Diskussion politische Rücktritte, sprachliche Nebelgranaten und ein merkwürdiges Schweigen dort, wo Führung gefragt wäre. Wenn Persönlichkeiten sich verabschieden, die die Schweizer Politik substantiell geprägt haben, wie es Pfister und Burkart taten, dann geht es dabei mehr als nur um persönliche Entscheidungen. Sie symbolisieren einen Bruch. Einen Bruch in der politischen Identität der Schweiz, weil das Paket Schweiz-EU die Souveränität des Landes zweifellos existentiell und nachhaltig in Frage stellt. Hinzu kommt, dass die Parteien Gefahr laufen, ihre Integrität zu verlieren, weil sie aus kurzfristigen Motiven das Wohl der Schweiz aus den Augen verlieren.
So sitze ich da, schreibe und frage mich, was da wohl auf uns zukommen wird. Ich vermute, dieses Mal wird es wenig Versöhnliches zum Geburtstag der Schweiz sein. Aber es ist zu wichtig, um nicht den Finger auf die wunden Punkte zu legen.
Der Moment der Leere ist ohrenbetäubend laut.
Zwei Rücktritte also. Zwei Präsidenten von zwei staatstragenden Parteien. Zwei Schweigen zur Unzeit. Die Schweiz steht vor dem grössten Umbau ihrer institutionellen Architektur seit dem EWR-Nein, möglicherweise seit ihrer Gründung, denn es haben unbemerkt Bauarbeiten am Fundament der Schweiz begonnen. Jetzt ausgerechnet verlassen Thierry Burkart (FDP) und Gerhard Pfister (Die Mitte) ihre Posten. Was offiziell als berufliche Neuorientierung daherkommt, wirkt in Wahrheit - ob es einem gefällt oder nicht - wie ein Rückzug aus der Verantwortung. Das nun spürbare Vakuum ist offensichtlich (oder zwei Vakua, um exakt zu sein). Wer führt jetzt? Wer redet Klartext?
Bitte verstehen Sie mich richtig. Selbstverständlich ist die Entscheidung zu respektieren. Niemand, der nicht selbst dringesteckt hat, kann sich vorstellen, wie kräftezehrend solche Ämter sind. In der Doppelbelastung mit Ständerats- oder Nationalratsmandat, möglicherweise noch in einer Milizfunktion, wird die Belastung unmenschlich, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Dazu stets im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, die kein, aber gar kein Pardon kennt und immer irgendetwas von einem will. Dennoch, oder gerade weil diese beiden kompetenten Protagonisten jetzt so unverzichtbar wären, lassen mich die praktisch lotsenfreien Parteiboote jetzt gerade sehr ratlos zurück.
Oh du unglückliche FDP. Wählst die Macht und nicht das Land?
Natürlich habe ich die FDP gewählt, weil ich wusste, wofür sie einmal stand: Eigenverantwortung, Freiheit, Einschränkung von Staatsmacht. Ihr damaliger Slogan prägte eine ganze Epoche: „Mehr Freiheit, weniger Staat“. Doch heute? Was ist davon geblieben? Da steht eine Partei vor einem Vertragswerk, das genau das Gegenteil dessen verlangt: Dynamische Rechtsübernahme ist das Stichwort. Keine reale Mitbestimmung oder konstruktives Gestalten in der Gesetzgebung, schon gar nicht auf gleicher Augenhöhe mit der EU. Keine wirksame Vetomöglichkeit, wenn das Ganze für die Schweiz ungeniessbar ist. Friss oder stirb, wäre wohl die polemische Parole dazu. Zusätzlich ein Eskalationsmechanismus, der nur auf dem Papier existiert, weil er nie aufgerufen wird, weil die Schweiz vor möglichen Folgen der übermächtigen EU zu grosse Angst hat. Verständlich und nachvollziehbar, wir alle haben es ja die letzten Jahre mehrfach so erlebt und unlöschbar registriert.
Wer Thierry Burkart zuhört, glaubt zu spüren, dass er diesen Bruch erkannt hat. Dass er mit sich gerungen hat und die sich abzeichnende Repositionierung letztlich nicht mittragen wollte (oder konnte). Dass er nicht der Parteipräsident sein wollte, der seine Basis in einen Systemwechsel führt, den sie kaum versteht und dessen Folgen unabsehbar sind. Wie gesagt, der Rücktritt ist ja nachvollziehbar. Dennoch, er ist nicht gut. Weder für die Partei noch die Schweiz. Bei Gerhard Pfister ist wenigstens schon ein Neuer im Amt. Doch es ist zu befürchten, dass, bis Philipp Matthias Bregy auf Hochtouren kommt, die wichtigsten Weichen im Paket Schweiz-EU wohl bereits gestellt sind. Oder auch er muss Übermenschliches leisten, damit der Fahrplan doch noch passt. Ein Fahrplan über der Höchstgeschwindigkeit des Schweizer Taktes, wer hat das eigentlich so eingeleitet?
Ignazio Cassis, der Bundesrat der FDP, steht für das Paket. Noch 2021 hatte er öffentlich den Reset-Knopf in den Beziehungen zur EU gedrückt: Weg von der starren Dynamik, hin zu einem neuen Denken. Er wäre in der Position gewesen, einen echten Richtungsentscheid herbeizuführen. Nicht gegen Europa, aber für ein Modell, das der Schweiz gerecht wird. Stattdessen blieb es beim Alten.
Vielmehr ist er es heute, der dieses Paket verteidigt und mit Hilfe von Viola Amherd vorangetrieben hat, nicht zuletzt wohl auch, damit ihr dazu der Handshake mit der EU-Kommissionspräsidentin möglich wurde. Cassis wurde so jener, der genau diese Dynamik der automatischen Übernahme von EU-Recht zur unumkehrbaren Systemarchitektur erhoben hat. Man fragt sich: Hat er sich verändert, oder wurde er eingeholt? Hat er realisiert, dass die Front im EDA viel zu breit gegen ihn aufgestellt war? Holte er sich die nötige Unterstützung für den Bundesratsentscheid zu Gunsten des Pakets von den linken BundesrätInnen und dem links zugewandten Mitte-Bundesrat Martin Pfister? Es wäre ihm nicht zu verübeln, aber dieser traurige Pakt ist falsch. Denn lieber kein Paket als ein schlechtes Paket. Schlecht ist, wenn die Schweiz im Gegenzug ihre Souveränität schrittweise opfern muss. Jetzt würde ein Abbruch der Verhandlungen noch viel schwerer als damals 2021, als Guy Parmelin ihn verkündete und meinte «Die Differenzen zwischen der EU und der Schweiz bleiben gross». Was soll der Bundesrat heute sagen, wenn er feststellt, dass das Paket nicht mehrheitsfähig ist? Ist sich der Bundesrat bewusst, in welche Sackgasse er sich mit seinem Vorgehen gebracht hat, indem er Neuverhandlungen ohne genügenden Rückhalt vom Souverän lanciert hat?
Klar ist auch, dass ein offener Konflikt zwischen Burkart und Cassis die FDP gespalten und womöglich ihren zweiten Bundesratssitz gefährdet hätte. Mit ziemlicher Sicherheit. Cassis benötigt die Unterstützung von Links, wenn er weiter regieren will.
Also geht nun Burkart. Und mit ihm geht die Führung. Die Partei bleibt zurück. Beim unglücklichen Versuch, Gewissenskonflikt und Machtkalkül zu kaschieren.
Das Parteigezänk der FDP hat das Potential, jetzt die Schweiz zu zerstören.
Läge dieses Paket jetzt nicht auf dem Tisch, dann wäre das Risiko auf die FDP begrenzt. Doch mit dem Paket Schweiz-EU ist das ganze Land betroffen. Die Lame Duck im FDP-Präsidium hinterlässt ein Vakuum, das umso rascher aufgefüllt werden will. Unkoordinierbar, wie denn auch sonst, wenn erst der 18. Oktober Klarheit bringen soll?
Wer jetzt spricht, spricht mit technokratischer Stimme. Simon Michel behauptet, es gehe nicht mehr um die Verträge, sondern nur noch um deren Umsetzung. Eine juristische Nebelwand, denn die Aussage ist missverständlich, ja falsch. In der Medienmitteilung zur Vernehmlassung vom 13. Juni 2025 führt der Bundesrat unmissverständlich zuerst die 13 Abkommen auf und erst danach die Umsetzungsgesetze. Die Verträge stehen also sehr wohl zur Diskussion. Sie sind der Prüfstein. Alles andere kommt danach und ist nur der ordentliche Vollzug.
Oder Konflikte drohen offen aufzubrechen: Die Bernerin Christa Markwalder zischt auf X zu Filippo Leutenegger, wer denn die Zürcher FDP legitimiert hätte, die vom «freisinnigen Aussenminister Ignazio Cassis überzeugend gut ausgehandelten Bilateralen III derart zu torpedieren»? Oder was soll man davon halten, wenn Simon Michel auf LinkedIn seinen Parteikollegen Christian Wasserfallen als «NICHT repräsentativ für unsere Partei» tituliert? Ein Versuch, andere Meinungen ruhig zu stellen? Stellt sich die FDP etwa so einen demokratischen Diskurs vor? Einheitsparteimässigkeit nun also auch in der FDP? Unappetitlich undemokratisch wird es, wenn plötzlich nur noch gerade die eigene Meinung Parteilinie ist.
Der Versuch einerseits, die Diskussion zu verengen, ist kein Zufall. Es ist ein Machtinstrument. Wer das Terrain kontrolliert, kontrolliert die Deutung. Anderseits wird die Debatte unweigerlich aus dem Ruder laufen, denn die Lager sind aufgrund der immensen Tragweite für die Schweiz für eine kontrollierte und konstruktive Auseinandersetzung zu unversöhnlich, und Deutungshoheit droht unweigerlich verloren zu gehen.
Schwerwiegend ist jedoch: Diese Ablenkungsmanöver opfern das Recht des Souveräns, die Verträge zu lesen, zu verstehen und sorgfältig zu beurteilen, bevor sie Realität werden. So gesehen ist aus meiner Sicht diese Scharade der FDP (notabene als massgebende Gründungspartei der Schweiz) in keinster Weise würdig und schlicht auch gefährlich, weil damit die Chance/Gefahr einer Eingliederung in die EU spürbar steigt, wenn die FDP geschwächt wird. Für die Befürworter hätte nichts Besseres passieren können. Sie sitzen in der ersten Reihe im FDP-Kino. Die Cassis-Geheimniskrämerei um die Verträge hätte mir als Polittheater längstens gereicht.
Denn wer will schon einen EU-Beitritt ohne Mitbestimmung?
Ich habe das Stromabkommen analysiert («Das Stromabkommen im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit.»). Was da steht, ist keine blosse Marktöffnung. Es ist eine institutionelle Neuordnung. EU-Recht gilt künftig unmittelbar in der Schweiz, Dank der Integrationsmethode ohne innerstaatliches Umsetzungsrecht. Wie oft muss man diesen Fakt wiederholen, bis er geglaubt wird? In fünf Bereichen: Strom, Freizügigkeit, Lebensmittelsicherheit, Gesundheit und Luftverkehr gilt exakt dieser Meccano nach der Integrationsmethode. Allein das Stromabkommen beinhaltet im Anhang I zwanzig umfangreiche EU-Rechtsakte, also EU-Gesetze, die sofort auch in der Schweiz gelten würden (siehe A-I). Hinzu kommen alle Zukünftigen und die laufenden Änderungen.
Das ist noch nicht alles, hier weitere Beispiele aus dem Stromabkommen:
Im Bereich Marktsteuerung verpflichtet sich die Schweiz zur vollständigen und dynamischen Übernahme sämtlicher Methodologien und Regeln zur Kapazitätsberechnung, Netzbewirtschaftung und Plattformkopplung (sogenannte TCM und algorithmische Verfahren), wie sie in Anhang III aufgeführt sind. Diese Methodologien gelten unmittelbar auf Schweizer Hoheitsgebiet (ohne Vetorecht) und unterliegen laufenden Änderungen durch ACER, ENTSO-E und die Europäische Kommission (siehe Anhang III A-III und Artikel 27 Absatz 3 V-V2).
Im Bereich staatliche Beihilfen verpflichtet sich die Schweiz zur dynamischen und direkten Übernahme sämtlicher relevanter EU-Vorschriften (inklusive sektorspezifischer Regelungen für Energie, Umwelt und Klimaschutz), wie sie in Anhang IV aufgeführt sind. Diese Vorgaben gelten unmittelbar in der Schweiz und müssen bei jeder Weiterentwicklung automatisch angepasst werden (siehe Anhang IV A-IV, Artikel 14 Absatz 2 V-III, Artikel 27 Absatz 3 V-V2).
Im Bereich Umwelt verpflichtet sich die Schweiz zur vollständigen und dynamischen Übernahme von sechs EU-Rechtsakten (darunter zur Umweltverträglichkeitsprüfung, zur Luftreinhaltung, zum Gewässerschutz oder zur Industrieemission), die direkt auf Schweizer Hoheitsgebiet wirken und bei jeder Änderung automatisch angepasst werden müssen (siehe Anhang V A-V und Artikel 27 Absatz 3 V-V2).
Im Bereich der erneuerbaren Energien verpflichtet sich die Schweiz zur dynamischen Übernahme aller relevanten EU-Vorschriften, wie sie in Anhang VI aufgelistet sind. Diese Bestimmungen betreffen unter anderem die Förderung, den Netzzugang und die Nachhaltigkeitskriterien und gelten direkt auf Schweizer Hoheitsgebiet – einschliesslich künftiger Änderungen durch neue EU-Rechtsakte (siehe Anhang VI A-VI und Artikel 27 Absatz 3 V-V2)
Der Aufwand wird gigantisch.
Wer glaubt, das seien bloss technische Fragen, hat nicht verstanden, was staatliche Steuerung ist. Er hat nicht verstanden, wie perfekt, fein und listig die Brüsseler Bürokratie den kleinen und offensichtlich naiven Staat Schweiz um den Finger gewickelt hat. Besser gesagt, lautlos übernehmen wird. Klappt das nicht, dann notfalls wieder mit Steinbrücks Kavallerie, wenn die Schweizer nicht genügend spuren. Institutionelles Protokoll mit Eskalationsmechanismus und Schiedsgericht nennt sich dieses Ding. Notabene betreffen von 1117 Seiten Vertragstext des ganzen Pakets über ein Drittel (37%) nur Vertragstexte darüber, was bei einem Konflikt zwischen der Schweiz und der EU zu passieren hat. Die EU hat hier quasi die Kavallerie als Paragraphen eingebaut im Wissen, dass sie nie ausreiten muss, denn die EU-Schweiz möchte doch so gerne nicht mehr das Loch im Donut, sondern Teil dieser grossartigen EU sein. Nicht mehr Donut, sondern die Konfitüre vom Vogelnestli möchte die EU-Schweiz sein.
Man nennt es „dynamische Rechtsübernahme“. Doch dynamisch ist hier nur eines: Der Verlust der Kontrolle. Denn selbst wenn die Schweiz eine neue EU-Regel ablehnt, gilt sie trotzdem vorläufig. Das hat die EU im Stromabkommen im Artikel 28 Absatz 3 so verankert (siehe V-V2). Und genau das bedeutet trotz kleinem Hintertürchen im Text: Brüssel entscheidet, was auf Schweizer Boden gilt. Nicht mehr Bern. Nicht mehr die Kantone. Nicht mehr der Souverän. Nicht mehr die Menschen. Was würde das für ein Durcheinander geben, wenn plötzlich niemand mehr weiss, was «vorläufig» gilt: Das Schweizer oder das EU-Recht? Oder beides? Und die Folgen? Das Schweizer Recht wird durch EU-Recht ersetzt. Das Schweizer Recht wird langsam, aber sicher aufgelöst. Das ist eine Zersetzung des Landes in Raten. Auf Nimmerwiedersehen, direkte Demokratie.
Wie dumm muss man bloss sein, der EU beizutreten, mitzuzahlen und im Gegenzug kein Mitbestimmungsrecht zu erhalten? Wer, um Gottes Willen, hat eine derart naive, ideologisch falsch gesteuerte oder egoistisch verdrehte Vorstellung über das vorliegende Paket Schweiz-EU? Wer kommt bloss auf der Schweizer Seite auf eine so hirnrissige Idee?
Glauben Befürworter ernsthaft, dass der EU-Vollbeitritt folglich der nächste Schritt sein könnte und dann alles in Ordnung wäre? Doch sie hätten die Rechnung ohne die EU gemacht: Wieso soll die EU die Schweiz bloss aufnehmen, wenn sie sie auch ohne Mitbestimmungsrecht haben kann? So schmeckt ein Berliner Pfannkuchen. Die Schweiz quasi als überraschende Marmeladefüllung, für die man nichts bezahlen muss.
Diese institutionelle Architektur entspricht keinem partnerschaftlichen Verhältnis, sondern einem asymmetrischen Ordnungsmodell. Die Schweiz wäre in zentralen Bereichen rechtlich faktisch eingebunden, ohne gestalterisch beteiligt zu sein. Genau das ist nicht Kooperation, sondern institutionelle Eingliederung. Nehmen Sie den Begriff «Unterordnung», wenn Sie ihn passender finden.
Der Gipfel ist: Die Schweiz tut es ohne Not. Eine gegenseitige Anerkennung des jeweiligen Rechts täte es längstens. Ohne Verlust der Souveränität. Einfach partnerschaftlich, wie das europäische Staaten im aktuellen Jahrtausend miteinander tun könnten und auch tun, wenn sie nicht von einer supranationalen Organisation behindert und falsch gesteuert werden. Ich frage mich wiederholt: Wieso bloss gibt die Schweiz sich auf?
Die Schweiz als System ohne Rückgrat.
Gerhard Pfister hat recht, wenn er sagt, die Verträge müssten angeschaut werden. Doch er zieht sich zurück, bevor das Gespräch überhaupt beginnt. Er ist jetzt neu Kritiker im Literaturclub des Schweizer Fernsehens. Entschuldigen Sie, Herr Pfister, aber das ist doch grotesk. Bei allem Respekt. Man kann nicht jahrelang die Politik prägen und sich beim wichtigsten Thema verabschieden. Doch – Pfister kann. Wir haben es zu akzeptieren. In der Hoffnung, dass ihm seine neue Kritikerrolle jenen Ausgleich gibt, damit er als Nationalrat eine umso pointiertere und gewichtigere Stimme bleibt.
Die SP? Die SP schweigt und geniesst die Selbstzerstörung der FDP. Das Lesen des Pakets ist den Jungsozialisten wahrscheinlich sowieso zu anstrengend. Die Grünen freuen sich an der automatischen Übernahme von EU-Recht in den Bereichen Umwelt und erneuerbare Energien (siehe oben). Sie merken nicht, dass damit auch Atomkraft als «nachhaltig» eingestuft werden könnte, wenn die EU ihre Taxonomie-Regeln in einen der automatisch zu übernehmenden Rechtsakte integriert. Denn dort gelten AKWs bereits heute als grüne Technologie. Die GLP werde das Paket freigeben, wie Jürg Grossen bereits signalisiert. Die SVP redet, aber niemand hört mehr zu; ihre Parolen haben sich abgenutzt. Und die Medienlandschaft? Zwischen Copy-Paste-Kommunikation und vorsichtiger Staatstreue. Einige wenige löbliche Ausnahmen, die dann aber erfrischend und fundiert berichten (NZZ, Bern einfach).
Ich frage mich: Wie konnte es so weit kommen? Wie kann ein Land mit direkter Demokratie, mit einem Verfassungsartikel 2, der Unabhängigkeit von aussen garantiert, und mit jahrzehntelanger Souveränität, solche Verträge ernsthaft und ohne Weiteres ratifizieren? Wie kann man diesen Coup auf einen politischen Gesetzgebungsvorgang reduzieren, wie ihn Simon Michel in seinem LinkedIn-Video den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger paternalistisch erklärt? Bloss die Merkel-Raute und ihr «wir schaffen das» fehlen noch, und dann hat die Schweiz den Tiefstand deutscher Politik erreicht. Haben wir verlernt, den politischen Ernstfall zu erkennen? Oder sind wir einfach alle mit uns selbst zu beschäftigt und überlassen den anderen - wie der deutsche Bundeskanzler in anderem Zusammenhang meint - die Drecksarbeit?
Es droht ein böses Erwachen. Vielleicht nicht heute, aber spätestens übermorgen.
Drei Szenarien drängen sich auf.
Szenario (aus heutiger Sicht das Wahrscheinlichste): Die Verträge werden durchgewunken. Das Parlament nickt. Die Öffentlichkeit bleibt träge. Das Referendum kommt spät, schwach und gespalten. Die Abstimmung wird zur Vertrauensfrage: Bund oder Chaos? Das Volk sagt zum Paket Ja. Die Schweiz nivelliert sich über die Jahre nach unten auf EU-Durchschnitt und wird Mühe bekunden, den Niedergang zu bremsen und nicht noch weiter nach hinten zu fallen. Wieso? Weil sie ihre Erfolgsposition, die flexible Souveränität faktisch aufgegeben hat.
Szenario (sehr unwahrscheinlich, weil die FDP zu zersplittert ist): Die FDP wagt den Aufbruch. Die Nachfolge Burkarts wird zur Richtungswahl. Bleibt man weiter unklar, oder kehrt man zurück zur liberalen Urhaltung? Doch wer füllt das Vakuum? Wer traut sich, gegen den eigenen Bundesrat zu opponieren? Wer spricht im Namen der Bürgerinnen und Bürger? Wahrscheinlich niemand. Die Konsequenz? Siehe Szenario 1.
Szenario (auch unwahrscheinlich, weil zu viele Regierende, Politiker und Beamte ihr Gesicht verlieren müssten): Eine neue Debatte entsteht. Nicht aus den Parteien, sondern von unten. Von Bürgerinnen und Bürgern, die sich erinnern, dass Freiheit nicht im Paket geliefert wird, sondern jeden Tag neu erstritten werden muss. Es sind jedoch zu wenige, und die Wenigen werden einfach ignoriert. Problem erledigt. Fortführung gemäss Szenario 1.
Wenn nach der Vernehmlassung kein radikales Umdenken erfolgt, dann ist der Mist geführt (siehe Szenarien 1 bis 3). Für den Widerstand gibt es eine rote Linie: Keine institutionelle Anbindung ohne bedingungsloses Vetorecht für die Schweiz. Ein Opt-Out ist das absolut Mindeste, was die Schweiz verdient. Wenn die EU nicht mitmacht, dann ist Schluss mit diesem Paket. Dies wäre das wahre Alternativ-Szenario zum aktuellen Vorgang. Es wäre das Resultat der Vernehmlassung. Es könnte eintreffen, wenn die Schweiz realisiert, wie ihr eigentlich geschieht.
Es benötigt jetzt eine klare Kante: Keine automatische Übernahme von EU-Recht ohne Veto-Recht, und zwar ohne Wenn und Aber.
Die Verträge müssen jetzt auf den Tisch. Nicht nach der Parlamentsdebatte. Nicht im Schatten eines weiteren Sommers. Nicht in den Kämmerlein des Bundeshauses, nicht länger off-the-record. Jetzt, in der Vernehmlassung, wo noch diskutiert werden darf.
Wir müssen fragen: Was bedeutet es, wenn Recht von aussen kommt, ohne demokratische Legitimation? Wenn Verträge gelten, obwohl sie nie in einem Parlament beraten wurden? Wenn die Schweiz ihre Entscheide nach Brüssel mit juristisch glatter Sprache, aber existentiellen Folgen outsourced?
Es braucht eine Rückkehr zur demokratischen Nüchternheit: Wir müssen verstehen, was auf dem Tisch liegt und benennen, was nicht geht. Wir müssen verstehen, was unsere Erfolgsrezepte sind. Wir müssen fordern, was nötig ist. Und verweigern, was die Grundlagen unseres Staates untergräbt. Daher fordern wir Nachverhandlungen für das Paket Schweiz-EU, die mindestens diese unsägliche und undemokratische institutionelle Anbindung weg vom Tisch bringt.
Unsere Freiheit steht auf dem Spiel. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich schreibe diese Zeilen als jemand, der sich vorstellen kann, wie wertvoll Freiheit ist. Als jemand, der in Ländern wie China, Russland oder der DDR möglicherweise sein Leben nicht hätte leben können. Als jemand, der seine Selbstbestimmung auch darin sieht, anders leben, denken, handeln zu dürfen als die Mehrheit. Das geht nur, weil wir ein System haben, das dem Einzelnen Rechte zusichert und die Mehrheit dafür Sorge trägt. Dafür bin ich sehr dankbar.
Sehnsucht ist der Stoff, aus dem die Träume der Menschen sind. Freiheit ist der Stoff, der Menschen zum Erfolg bringt. Das Kollektiv befähigt sie für ihren eigenen Erfolg und weiss, dass der Gesamterfolg mehr als die Summe davon ist. Die Allgemeinheit lässt das Individuum stark und stolz auf sein Geleistetes werden. So funktioniert das konstruktive Leistungsprinzip und damit der Wohlstand für möglichst alle. Nicht nur für Wenige. Weil so reale Wertschöpfung multipliziert wird. Es ist der Schlüssel des Schweizer Erfolges. Oder des amerikanischen Traums. Oder des chinesischen Aufbruchs. Staatliche Institutionen haben nur einen Zweck: Beste Voraussetzungen für den individuellen Erfolg ihrer Menschen zu schaffen, auch für die Schwächsten. Tun sie es nicht, verlieren die Staaten ihre Legitimation und werden zu reinen Machtkonstrukten. Dann erniedrigen sie ihre Menschen. Dann brechen sie den Gesellschaftsvertrag mit ihnen: Sicherheit für den individuellen Erfolg gegen Bezahlung von Steuern. Alles andere stellt Bereicherung einiger Weniger dar und hat mit Freiheit und Demokratie nichts mehr zu tun. Es gibt zahllose Beispiele dafür. Die Schweiz ist wohl weltweit das einzige Land, das den Gegenentwurf lebt. Seit Jahrhunderten erfolgreich. Die Menschen in der Schweiz sind die Glücklichsten weltweit.
Die EU ist kein Feind. Aber ein System, das Integration über Demokratie stellt, ist für die Schweiz kein Vorbild. Die Schweiz lebt die Dezentralität pragmatisch, systematisch und äusserst erfolgreich. Dezentralität ist unser Ausdruck maximaler Freiheit in einem grossen Ganzen. Die EU versucht die Zentralität mehr schlecht als recht. Sie minimiert die Freiheit ihrer Mitglieder. Sie schränkt sie ein und konzentriert die Macht im Zentrum einer gesichtslosen Bürokratie in Brüssel. Wer als Schweizerin oder Schweizer solche Verträge verhandelt, ohne sich dieser Konsequenzen bewusst zu sein, hat vergessen, was das Erfolgsmodell der Schweiz ausmacht.
Noch ist es nicht zu spät. Noch kann man darüber reden. Noch steht die Schweiz. Aber dieses Paket ist der Hebel zu ihrer Selbstauflösung. Schweigen geht jetzt nicht mehr. Die schweigende Mehrheit ist gefragt. Nicht Regierung, Parlament und Politik, die jederzeit gehen können. Sondern der Souverän, der bleibt und nicht zurücktreten kann. Dazu soll jetzt niemand mehr sagen können, er oder sie hätte es nicht gewusst.
Jetzt handeln, bevor es reisst.
Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die politische Steuerung der Schweiz. Es ersetzt demokratische Gestaltungsprozesse durch Nachvollzug. Es bricht die Parteien auf und lässt den Souverän im Regen stehen.
Wer das nicht sehen will, verdrängt. Wer es sieht und schweigt, verpasst seine Aufgabe. Wer es sieht und handelt, verdient Unterstützung. Wer falsch handelt, muss jetzt mit Zurechtweisung rechnen. Die Schweiz hat in ihrer Geschichte viele kritische Momente erlebt. Dieser ist einer davon. Vielleicht der entscheidende.
Epilog.
Oh du heilige Helvetia, was passiert da nur mit dir?
Ich frage mich, wieso ich als Normalbürger diese Kritik üben muss. Übersehe ich Wesentliches? Oder bin ich einfach aus der Zeit gefallen und die Schweiz, wie ich sie kannte, hat sich längst überlebt? Und Helvetia ist bereits nach ihrem Rücktritt in anderen Gefilden ausserhalb der Schweiz unterwegs? Denn im Licht dieses Pakets schaue ich auf die FDP und erkenne die Partei nicht mehr, die ich einst gewählt habe. Ja, ich bin enttäuscht. Ich hoffe, dass sich die FDP wieder fängt und für mich wieder wählbar wird.
Doch noch läuft die Vernehmlassung. Noch sind die Verträge nicht unterzeichnet. Noch gibt es Raum für Kritik, für Argumente und für Alternativen. Wir alle sind jetzt gefragt: Die Parteien, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger. Nicht später und nicht erst dann, wenn es irgendwelche Instanzen für angemessen halten. Denn wenn das Paket kommt, kommt es mit voller institutioneller Wucht. Dann wird nicht mehr entschieden, wie wir mit Europa umgehen.
Dann wird entschieden sein, wie Europa mit uns umgeht.
Das Stromabkommen im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit.
Das neue Stromabkommen (Elektrizität) im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit ist ein zentrales Element des Pakets Schweiz–EU. Es offenbart im Perspektivenwechsel ein unerwartetes Ausmass an gegenläufigen Erwartungen der Vertragspartner. Wer eintauchen will, dieser Artikel ist die richtige Gelegenheit dazu.
(c) 2019: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Orginalwortlaut Stromabkommen - hier online verfügbar.
Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? Wir haben die 163 Seiten des Stromabkommens ordentlich strukturiert und im Originalwortlaut der EU auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Wir leisten damit einen Beitrag zur Lesbarkeit dieses Abkommens. Wir hoffen, dass viele so einen einfacheren Zugang dazu finden und unser Angebot nützlich ist.
Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint.
Ein umfassendes Paket von Abkommen zur Festigung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt jetzt auf dem Tisch. Es bildet die Grundlage für eine folgenschwere Entscheidung der Schweiz, die es ernsthaft auszuloten gilt.
(c) 2025, Schloss Wildegg, Möriken-Wildegg, Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser.
Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.
Hier finden Sie die Stellungnahme von smartmyway zum Paket Schweiz-EU im Rahmen der offiziellen Vernehmlassung.
(c) 2016: Gewittersturm, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
smartmyway unterwegs.
(c) 2017: Capanna Monte Bar, Capriasca, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.
Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management