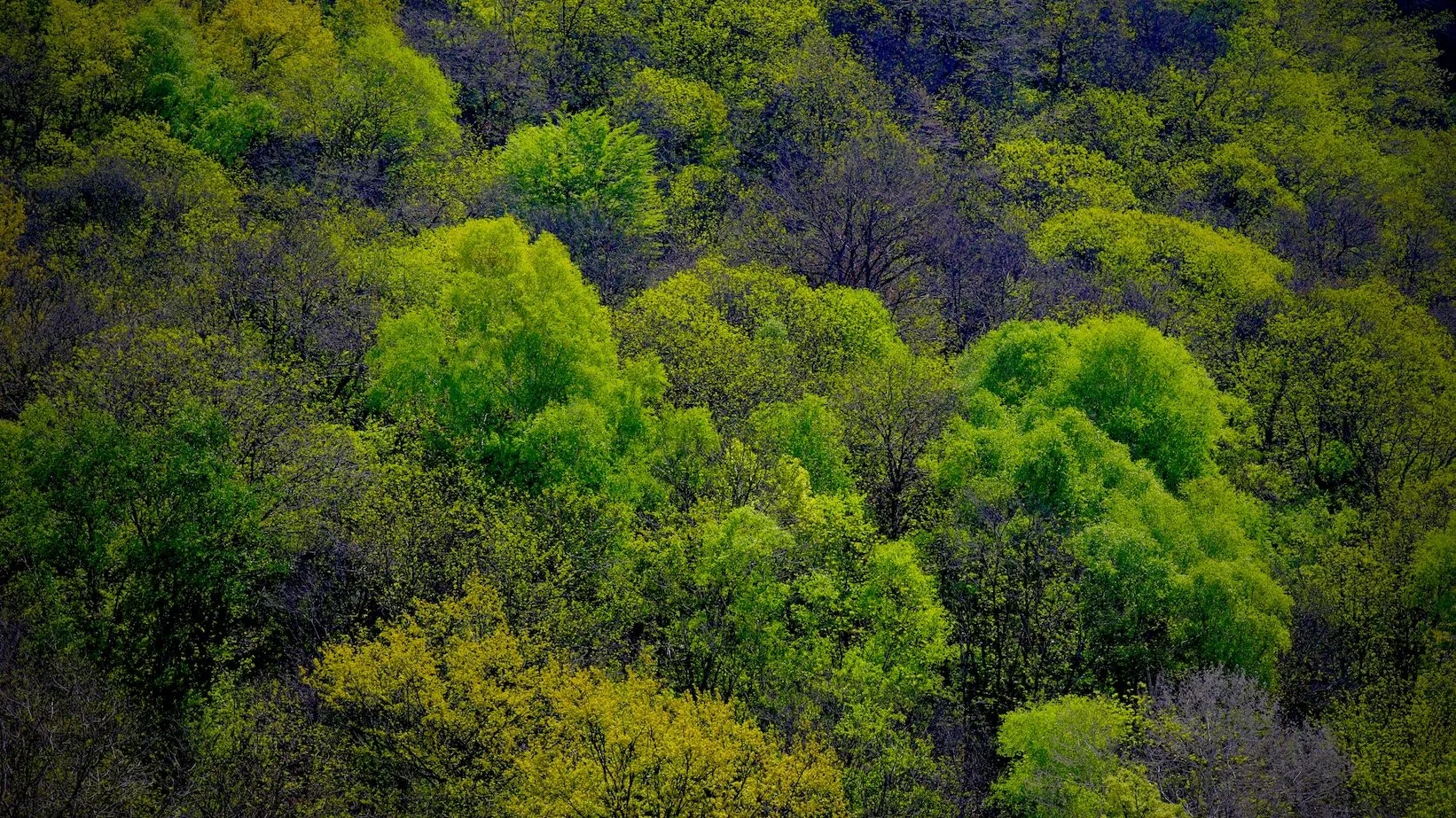Das Stromabkommen. Passt die Lösung zum Problem?

Das Stromabkommen aus dem Paket Schweiz-EU stellt Importgarantie und Souveränität zueinander ins Spannungsfeld. Nach der institutionellen Betrachtung prüfen wir, wie es aus Bürgersicht inhaltlich abschneidet. In unserem Fazit fragen wir uns, wie so eine Vorlage entstehen konnte.
Obwohl in der Schweiz derzeit vielleicht erst einige Tausend Personen näher mit dem Paket Schweiz-EU beschäftigt sind, kommt die Diskussion in Fahrt. Wir erleben einen Vorgeschmack dessen, was wohl vor der Abstimmung passieren wird. Die Komplexität des Vertragswerks erschwert eine sachliche Debatte.
Der vorliegende Artikel will zur Meinungsbildung einen konstruktiven Beitrag leisten und nimmt dazu das Stromabkommen aus inhaltlicher Sicht unter die Lupe. Wir tun dies anhand der offiziellen Unterlagen und mit gesundem Menschenverstand im Rahmen der aktuell laufenden Vernehmlassung. Es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, wie es besser gemacht werden könnte (was die Aufgabe des Bundesrates ist). Wir spiegeln vielmehr im Rahmen der Vernehmlassung dem Bundesrat unseren Eindruck zum vorliegenden Stromabkommen. Wir kommen zu einem Schluss, der uns nachdenklich stimmt.
Roland Voser, 11. August 2025
Hier finden Sie die Online-Quellen für folgende Themen: Vertragstext Freizügigkeitsabkommen, Vertragstext Stromabkommen, Lesehilfe EDA-Dokumente
Lesen Sie auch unsere Analyse zum Stromabkommen aus institutioneller Sicht (Link) und die Detailbetrachtung der institutionellen Elemente (Link).
1. Wo stehen wir zur Halbzeit?
Die Vernehmlassung des Bundesrates für das Paket Schweiz-EU dauert bis am 31. Oktober 2025. Bald ist Halbzeit. Es ist ein guter Zeitpunkt, eine Halbzeitbilanz zu ziehen, und wir tun dies anhand des Stromabkommens. Als Photovoltaik-Pioniere liegt uns dieses Abkommen am nächsten. Mit den anderen Abkommen befassen wir uns in der zweiten Halbzeit.
Wir hinterfragen also das Stromabkommen. Wir möchten wissen, was seine Absicht ist. Wir versuchen zu ergründen, welchen Standpunkt der Bundesrat und seine Autoren einnehmen.
Im Anschluss überlegen wir uns, was ein Stromabkommen der Schweiz nach gesundem Menschenverstand bringen sollte und ziehen aus dem Ganzen unser Fazit.
Wir vermeiden es, Sekundärquellen zu befragen, weil diese bereits Interpretationen enthalten. Unsere Quellen sind ausschliesslich die in der Vernehmlassung zur Verfügung gestellten Dokumente des Bundesrates (Link), möglicherweise ergänzt durch die relevanten Bestimmungen seitens der EU, oder wir führen die Quellen transparent auf.
2. Was wäre die Haltung des Bundesrates zum Stromabkommen?
Wir stellen uns die Frage, was der Bundesrat mit dem Stromabkommen bezweckt. Wir werden im Faktenblatt für das Stromabkommen fündig.
Der Bundesrat verspricht sich vom Stromabkommen durch rechtliche Absicherung und Einbindung der Schweiz in den EU-Strombinnenmarkt folgende Problemlösungen:
Stärkung der Versorgungssicherheit: Heute sind Grenzkapazitäten ungenügend gewährleistet. Dadurch erfolgt eine mögliche Einschränkung des Stromimports und eine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit.
Stärkung des sicheren Netzbetriebs: Heute ist Swissgrid (Betreiberin des Stromübertragungsnetzes) ungenügend in die EU eingebunden. Dies verursacht u.a. ungeplante Stromflüsse, Risiken und Mehrkosten.
Vereinfachung des Austauschs und Handels von Strom: Heute können Schweizer Stromversorger nicht am EU-Strombinnenmarkt teilnehmen. Die Schweizer Wasserkraft ist ungenügend vermarktet.
Der Bundesrat flankiert das Abkommen wie folgt:
Akzeptanzerhöhung in der Bevölkerung: Zusicherung, dass Haushalte und KMU weiterhin geschützt und die Grundversorgung zu regulierten Preisen gesichert bleibt.
Verbesserung der politischen Machbarkeit: Beibehaltung der öffentlichen Hand bei Versorgern (inkl. Personal), keine Eingriffe in Wasserzins- oder Konzessionshoheit, Schutz kantonaler Kompetenzen.
Verbesserung der Versorgungssicherheit: Sicherstellung, dass auch in Krisenzeiten Stromimporte nicht beschränkt werden und eigene Reserven möglich bleiben.
Absicherung bestehender Vorteile: Anerkennung von Herkunftsnachweisen und Absicherung bestehender Fördermodelle sollen zeigen, dass das Abkommen bisherige Investitionen nicht gefährdet.
Reduktion der Hemmschwelle: EU-Umweltrecht nur als Mindeststandard zu übernehmen, signalisiert, dass nationale Standards beibehalten oder erhöht werden können.
3. Wieso ein umfassendes Stromabkommen, wenn 3 eingrenzbare Probleme zu lösen sind?
Der Standpunkt des Bundesrates ist nachvollziehbar und durchaus sinnvoll. Es stellt sich aber die Frage, ob die gewählte Lösung verhältnismässig ist: Denn rechtfertigt diese isolierte Problemlösung die Übernahme und laufende Aktualisierung von 796 Seiten EU-Recht (gemäss der 20 EU-Rechtsakte im Anhang I des Stromabkommens, siehe Link)?
Hätten diese drei Probleme nicht anderweitig gelöst werden können? Schliesslich hat die Schweiz ihre Versorgungssicherheit bislang auch ohne formelle Vollintegration in den EU-Strommarkt gewährleistet. Selbst der Status Quo ist unseres Erachtens aus dieser Sicht als Fortführung vertretbar.
Der Bundesrat beantwortet diese Frage im Faktenblatt nicht. Es lässt offen, ob der eingeschlagene Weg tatsächlich die einzige Möglichkeit oder nur der Bevorzugte ist.
Wir schliessen daraus, dass ein Stromabkommen auch aus anderen Gründen forciert wurde, die unerwähnt bleiben. Die Lösung erscheint für den umrissenen Problemrahmen überdimensioniert. Sie nimmt möglicherweise Nachteile in Kauf, die sich vermeiden liessen.
4. Was verspricht sich der Bundesrat von einem Stromabkommen?
Versetzen wir uns in die Lage des Bundesrates. Was erhofft er sich aus dem Stromabkommen? Was sind seine Annahmen? Wir haben dazu drei mögliche Annahmen identifiziert.
a. Die EU hält sich in Krisen an die Binnenmarktregeln.
Der Bundesrat hält im Faktenblatt fest: «Mit einem Stromabkommen dürfen Nachbarstaaten Stromflüsse in die Schweiz nicht einschränken (im Sinne von Exportbeschränkungen), auch im Fall einer Energiekrise nicht. Im Stromabkommen wird explizit festgehalten, dass Grenzkapazitäten gerade auch in Krisenzeiten zur Verfügung stehen.»
Er stellt die Importgarantie und die diskriminierungsfreie Zuteilung von Grenzkapazitäten damit als einen zentralen Nutzen des Stromabkommens dar. Er argumentiert, dass die Versorgungssicherheit der Schweiz so auch in Krisenzeiten gewährleistet werde, weil Nachbarstaaten den Stromfluss nicht einschränken dürften.
Damit dieses Versprechen tatsächlich trägt, muss der Bundesrat jedoch implizit davon ausgehen, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten diese Regeln auch unter aussergewöhnlichen Bedingungen einhalten.
Ohne diese Annahme wäre die Importgarantie im Ernstfall politisch und praktisch nicht garantiert, und eines seiner Hauptargumente für das Stromabkommen wäre nicht mehr stichhaltig.
Frankreichs Atomproduktion fiel 2022 auf ein 30-Jahres‑Tief. Das Land wurde zeitweise Netto-Importeur und reduzierte faktisch Exportverfügbarkeit (auch wenn Paris einen formalen Exportstopp dementierte). Damit zeigt die Praxis, dass in Krisen nationale Zwänge dominieren und nicht zuerst die Solidaritätsmechanik zum Tragen kommt (Reuters).
b. Die Integration bringt Netto-Vorteile für Versorgungssicherheit, Preise und Effizienz.
Der Bundesrat hält im Faktenblatt fest: «Die Einbindung der Schweiz in den europäischen Strombinnenmarkt vereinfacht den Austausch und Handel mit Strom. Dank dem Abkommen werden die Versorgungssicherheit und der sichere Netzbetrieb gestärkt. Es ermöglicht einen optimalen Einsatz der flexiblen Schweizer Wasserkraft auf den europäischen Märkten, sichert die Stromimportfähigkeit der Schweiz, begünstigt wettbewerbsfähige Strompreise, reduziert Kosten der Stromversorgung und fördert den Übergang zu einem klimaneutralen Energiesystem.»
Er verknüpft damit die stärkere Integration direkt mit einer Reihe positiver Effekte.
Damit diese Argumentation trägt, muss der Bundesrat jedoch implizit davon ausgehen, dass diese wirtschaftlichen und technischen Vorteile auch langfristig und in unterschiedlichen Marktsituationen bestehen bleiben.
Sollte diese Annahme nicht eintreten, beispielsweise wenn Preise im EU-Binnenmarkt stark schwanken oder Kapazitäten im Krisenfall nicht verfügbar sind, würde ein zentrales Nutzenversprechen des Stromabkommens entfallen.
Die Annahme ist im Normalbetrieb plausibel, in Krisen jedoch nicht garantiert. 2022 explodierten europäische Strompreise teils auf über 600 €/MWh; Effizienzgewinne der Marktintegration konnten Preisschocks nicht verhindern (Bank for International Settlements).
c. Die vertraglichen Garantien sind praktisch durchsetzbar.
Der Bundesrat hält im Faktenblatt fest: «Mit dem Stromabkommen dürfen Nachbarstaaten Stromflüsse in die Schweiz nicht einschränken, auch im Fall einer Energiekrise nicht. […] Die Schweiz kann auch unter dem Stromabkommen notwendige Reserven im Inland erstellen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. […] Diese Flexibilität wurde als Ausnahme von der dynamischen Rechtsübernahme abgesichert.»
Er geht damit davon aus, dass diese vertraglich fixierten Zusicherungen im Bedarfsfall durchgesetzt werden können.
Damit diese Argumentation trägt, muss der Bundesrat jedoch implizit annehmen, dass die vertraglichen Mechanismen im Krisenfall schnell und wirksam greifen.
Sollte diese Annahme nicht zutreffen, beispielsweise wenn politische Interessen der Mitgliedstaaten oder langwierige Streitbeilegungsverfahren die Umsetzung verzögern, wären die Zusicherungen im Ernstfall gegenstandslos und ihre Schutzwirkung für die Schweiz aufgehoben.
Die Durchsetzbarkeit hängt von Verfahren und Zeit ab. Die EU-Rechtsdurchsetzung via Vertragsverletzungsverfahren dauert länger als Versorgungskrisen es zulassen würden (The Brussels Times).
5. Was wäre ein Zwischenfazit?
Das Stromabkommen erweist sich aus unserer Sicht als falsche Lösung für das vom Bundesrat identifizierte Problem. Der Bundesrat will drei eng umrissene Probleme mit einem überdimensionierten Integrationsvertrag lösen, der allein über die Integrationsmethode 796 Seiten EU-Recht in die Schweiz übernimmt und dort gültig wird.
Hinzu kommen Anpassungen gemäss Beschlussvorlage nach dem Äquivalenzansatz im Umfang von 26 Seiten Änderungen im Schweizer Recht. Ganze Themenkreise wie Umwelt (Anhang V) und Erneuerbare (Anhang VI) werden miteinbezogen.
Die zentralen Nutzenversprechen des Bundesrates beruhen auf drei Annahmen, von denen zwei in der Praxis fragil sind. Historische Krisen zeigen, dass Binnenmarktregeln ausgesetzt werden können, Preise trotz Integration stark schwanken und vertragliche Garantien zu langsam greifen.
Wenn nur eine dieser Annahmen nicht hält, bricht der Hauptnutzen für die Schweiz weg, während die Nachteile bestehen bleiben. So entsteht ein hohes Risiko, dass der Vertrag die Erwartungen der Schweiz nicht erfüllt.
Die zugrunde gelegte Problemdefinition scheint als zu eng gefasst oder einfach nicht passend für ein ausgewachsenes Stromabkommen.
Diese Vermutung soll nicht so im Raum stehen bleiben. Vielmehr ist diese These im Folgenden zu prüfen.
6. Was wäre das richtige Problem?
Um zu verstehen, ob das Stromabkommen sinnvoll ist, steigen wir bei der Beziehung zwischen Staat und Bürger ein. Wie sieht eine ausgeglichene Beziehung aus?
Wir beantworten dies wie folgt: Der Grundvertrag der Menschen mit ihrem Staat heisst «Steuern gegen Sicherheit». Ich bezahle und kann im Gegenzug sicher leben. Einfach, aber treffend, nicht wahr?
Daraus leitet sich ab, dass der Staat primär Dinge tun muss, die das Kollektiv besser erledigen kann als einzelne Individuen. Sicherheit zum Beispiel. Alles ergänzt durch faire Zusammenarbeitsregeln.
Dieser Grundgedanke gilt auch für das Stromabkommen, gerade weil die Aspekte eines klassischen Marktes nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr geht es bei Energie und Strom um das Rückgrat der Gesellschaft.
Ohne Strom ist die Gesellschaft nicht lebensfähig. Ein umfassendes Stromabkommen muss deshalb primär die Schlüsselfaktoren für die Versorgungssicherheit der Schweiz optimal sicherstellen.
7. Wie verhalten sich die Schlüsselfaktoren für die Versorgungssicherheit?
Das Stromabkommen müsste unseres Erachtens für die Schweiz eine durchgängige Verbesserung folgender fünf Schlüsselfaktoren bewirken (siehe auch den Anhang dieses Artikels). Dann wäre es aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger nützlich und anzustreben.
Diese sind:
I. Technische Stabilität und Wiederaufbau.
Die Handhabung der Stabilität des Stromnetzes und die Fähigkeit, es nach einem Ausfall wieder hochzufahren, verändert sich mit dem Stromabkommen wie folgt:
Krisensteuerung neu durch EU
Zuteilung von Stromdurchleitungen neu durch EU
Wiederaufbau des Netzes nach EU-Notfallplänen, nationale Prioritäten untergeordnet
II. Speicher und Kapazitätsreserven.
Die Möglichkeiten, Strom saisonal zu speichern und Reserven vorzuhalten, verändert sich wie folgt:
Kein exklusiver Zugriff mehr auf eigene Speicher für den Winter
Nationale Reserven bleiben erlaubt, müssen aber EU-Vorgaben entsprechen
Gespeicherte Kapazitäten können auch an andere EU-Staaten gehen
III. Import- und Exportfähigkeit.
Die Fähigkeit, Strom über Grenzen zu beziehen oder zu liefern, verändert sich wie folgt:
Zuteilung von Grenzkapazitäten neu durch EU
Verfügbarkeit auch in Krisen vertraglich zugesichert
Keine freie Wahl mehr, aus welchen Ländern Strom zuerst kommt
IV. Steuerung in Krisen.
Die Entscheidungshoheit über Prioritäten bei Stromknappheit verändert sich wie folgt:
Festlegung Importreihenfolge neu durch EU
Versorgung kritischer Infrastruktur neu durch EU
Direkte Sonderabsprachen mit Lieferländern nur noch eingeschränkt
V. Wirtschaftliche und politische Autonomie.
Der Gestaltungsspielraum bei Energiepolitik und Preisen verändert sich wie folgt:
Fördermodelle nur noch erlaubt, wenn sie EU-Beihilferecht entsprechen
Strompreise stärker von EU-Marktregeln beeinflusst
Weniger Möglichkeiten, Preise im Inland gezielt zu stabilisieren
Ein Beispiel verdeutlicht die Brisanz: Anhang II des Stromabkommens sieht vor, dass die bestehenden Stromlieferverträge in den nächsten 5 bis 15 Jahren auslaufen (siehe A-IIB). Zehn Verträge mit Frankreich, davon sechs für Kernkraft und vier für Wasserkraft. Diese decken heute eine Winterstromlücke von über einer Million Haushalten. Sie wurden 2023 nochmals mit grossem Aufwand verlängert, obwohl bereits damals unklar war, ob Frankreich im Ernstfall liefern kann. SRF hat diese Verträge 2022 als unverzichtbar eingeordnet (Link).
Fällt diese Absicherung weg, müsste die Schweiz entweder eigene Reservekapazitäten aufbauen oder sich auf Spotmarktimporte verlassen oder gar auf fossile Notkraftwerke wie in Birr. Mit Fairness oder Diskriminierungsverboten eines Binnenmarktes hat das nichts zu tun, es geht um professionelle Versorgungssicherheit.
8. Wie sind diese Schlüsselfaktoren zu bewerten?
Wir haben die fünf Schlüsselfaktoren für die Versorgungssicherheit bewertet. Dies je ohne und mit Stromabkommen, auf einer Skala von 1 bis 5. Entscheidend ist nicht die exakte Zahl, sondern das Muster: Wo steigt der Nutzen, wo sinkt er?
Sie können so auch ihre eigene Erwartung an das Stromabkommen formulieren.
Im Folgenden dazu unser Musterergebnis:
Erklärungsbeispiel: Die Schweiz verzeichnet ohne Stromabkommen bei allen 5 Schlüsselfaktoren bereits einen hohen Nutzen. Beispielsweise verfügt die Schweiz im Faktor II über eine exklusive Winterreserve.
Hier unsere Beurteilung:
Wo verliert die Schweiz? Deutliche Absenkung ist bei Speicher/Kapazitätsreserven, Steuerung in Krisen sowie wirtschaftlicher und politischer Autonomie erkennbar.
Wo gewinnt die EU? Eine klare Steigerung ist bei technischer Stabilität, Speicherzugriff und Kapazitätsreserven sowie bei der Import- und Exportfähigkeit ausgewiesen.
Was bleibt neutral oder gemischt? Technische Stabilität bleibt für die Schweiz relativ hoch, sinkt aber leicht. Die Import- und Exportfähigkeit verbessert sich in einzelnen Aspekten, verliert jedoch nationale Steuerungsrechte.
Aus unserer Sicht verlagert das Stromabkommen Nutzenpotenziale von der Schweiz zur EU. Die Gesamtbilanz fällt für die Schweiz nachteilig aus, weil zentrale Steuerungsrechte aufgegeben werden, während die EU in nahezu allen Faktoren gewinnt.
Unseres Erachtens ist das Stromabkommen somit auch aus der Gesamtbetrachtung nicht vorteilhaft für die Schweiz. Es ist asymmetrisch.
9. Woher kommt diese Asymmetrie?
Wir vermuten unterschiedliche Grundhaltungen zwischen den Befürwortern und damit des Bundesrates sowie den Kritikern des Stromabkommens.
Die Befürworter suchen Sicherheit in der Grösse. Sie streben eine passende Eingliederung in die EU an. Sie tun dies vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Megatrends wie Migration, Blockbildung, Digitalisierung/KI, denen die Schweiz nicht ausweichen kann.
Sie sind davon überzeugt, dass Komplexität zentral gegliedert und verwaltet am besten gehandhabt werden kann. Sie erhoffen sich Skaleneffekte und damit bessere Preise und tiefere Kosten.
Dafür übertragen sie die nötige Steuerungskompetenz in übergeordnete Hände und vertrauen auf faire Behandlung. Sie schränken damit im Gegenzug die eigene Handlungsfähigkeit spürbar ein, denn sonst wäre die Kompetenz am neuen Ort nicht wirkungsvoll genug.
Diese Handschrift ist bereits deutlich bei den institutionellen Aspekten zu erkennen, jetzt zeigt sie sich auch inhaltlich.
Auf der anderen Seite stehen die Kritiker. Sie verstehen Integration als Einschränkung der Unabhängigkeit. Sie befürchten den Verlust von Entscheidungsfreiheit und damit jener Flexibilität und entscheidender Vorteile, die ein Kleiner gegenüber Grossen ausspielen können muss.
Die Gegner sehen damit das Erfolgsrezept ihres kleinen Landes gefährdet. Hier kommt Opportunismus vor Einheitlichkeit zum Tragen, Geschwindigkeit vor Perfektion, Optimierung der Schweiz vor Optimierung Europas. Sie befürchten die Gefahr einer Nivellierung nach unten.
Ein Vertrag dieser Tragweite muss messbar mehr Sicherheit, Stabilität und wirtschaftlichen Vorteil für die Schweiz bringen, als er Risiken und Abhängigkeiten verursacht.
Das Stromabkommen erfüllt unseres Erachtens diesen Anspruch nicht.
10. Was ist unser Verdikt und was meinen Sie?
Mit diesem Artikel zur Halbzeit stellen wir Folgendes fest: Wir erachten die Vorgehensweise des Bundesrates mit dem Paket Schweiz-EU nicht nur institutionell, sondern auch inhaltlich unzureichend begründet.
Wir fällen dieses Verdikt auch, weil der Bundesrat jetzt primär das Parlament – aber auch seine interessierten Bürgerinnen und Bürger – in ungenügender Weise an die Materie heranführt, die so dem Anspruch an eine breit abgestützte Meinungsbildung nicht gerecht wird. Unter den derzeitigen Annahmen und ohne belastbare Antworten auf die offenen Fragen überwiegen für uns die Risiken. Deshalb würden wir das Stromabkommen heute ablehnen und es wie folgt begründen:
Das Stromabkommen ist für die Schweiz nachteilig, weil sie künftig die Deckung ihres Strombedarfs nicht mehr selbst steuern und auf ihre Menschen und Unternehmen optimieren kann. Die Versorgungssicherheit mit Strom ist das Rückgrat der Schweiz und bei der Energiewende zweifellos der wichtigste Erfolgsfaktor einer modernen und nachhaltigen Gesellschaft. Dieser muss perfekt auf die Bedürfnisse des Landes abgestimmt sein, weil er vor Ort wirken muss. Nicht in Brüssel.
Mit dem Stromabkommen verschiebt sich die Optik: Konkret würden im Krisenfall, beispielsweise bei einer Strommangellage, zentrale Entscheidungen wie die Importreihenfolge oder die Zuteilung von Grenzkapazitäten nach EU-weiten Kriterien erfolgen und nicht nach den spezifischen Bedürfnissen und Prioritäten der Schweiz.
Weiter ist heute nicht absehbar, welche Markteinflüsse auf die finanzielle Situation der Standortgemeinden und Eigentümerkantone der Schweizer Stromproduktion wirken werden. Dasselbe gilt für die Förderungskonzepte von Erneuerbaren: So ist beispielsweise die vom Bundesrat 2025 beschlossene Minimalvergütung für Einspeisung kleiner PV-Anlagen in der Beschlussvorlage nicht mehr auffindbar (EnG Artikel 15 Absatz 1bis Version 2026 und Version Beschlussvorlage).
Letztlich profitiert die EU, denn sie kann den Binnenmarkt aus der Gesamtsicht optimieren und dazu die Schweizer Strominfrastruktur einbeziehen, steuern und nutzen. Im Gegenzug muss die Schweiz einen erheblichen Teil ihres Rechts praktisch unumkehrbar durch EU-Recht ersetzen, was wiederum einer unnötigen Einschränkung ihrer Souveränität gleichkommt und direkt ihrem Erfolgsmodell entgegenläuft.
Wir fragen uns, was ein derart asymmetrisches und äussert umfangreiches Vertragswerk überhaupt bringen soll, denn erfahrungsgemäss werden die kritischen Abkommen in der EU von den Ländern nicht eingehalten. Versorgungssicherheit gehört definitiv in diese Kategorie. Die Schweiz kann sich jedoch als Nichtmitglied ohne Mitbestimmung und kleines Land ohne genügend Gewicht solche Regelwidrigkeiten nicht leisten und müsste mit massiven Sanktionen rechnen. Das ist die künftige Realität, auf die sich die Schweiz einstellen müsste.
Die Parlamentarier und interessierten Kreise werden während der Vernehmlassung nun ihre Schlüsse ziehen. Beim Stromabkommen wurde für uns klar, dass es nicht genügt zu sagen: «Das ist ein gutes Abkommen».
Was meinen Sie?
Anhang: Schlüsselfaktoren für Versorgungssicherheit.
I. Technische Stabilität und Wiederaufbau
Physikalische Netzstabilität (Fähigkeit des Stromnetzes, Spannung und Frequenz stabil zu halten, damit es nicht zu Blackouts kommt): Bleibt technisch erhalten, wird aber in EU-Krisenmechanismen koordiniert, was im Ernstfall eine schnellere, abgestimmte Stabilisierung des Netzes ermöglicht.
Stromtransit (Durchleitung von Strom aus anderen Ländern durch die Schweiz): Weiterhin möglich, aber Zuteilung folgt EU-Kapazitätsberechnungen statt Schweizer Steuerung; Einnahmen bleiben, doch politische Hebelwirkung und Vorrang für die eigene Versorgung gehen verloren.
Schwarzstart- und Wiederaufbau (Fähigkeit, das Netz nach einem kompletten Stromausfall selbstständig wieder hochzufahren): Fähigkeit bleibt unverändert, jedoch Pflicht zur Einbindung in EU-Notfallpläne; nationale Prioritäten wie vorrangige Versorgung kritischer Infrastrukturen, strategisch wichtiger Regionen oder eigener Reservekraftwerke könnten zugunsten einer EU-weiten Optimierung des Wiederaufbaus zurückgestellt werden.
II. Speicher und Kapazitätsreserven
Saisonale Speicher (Nutzung von Speicherseen und anderen Speichermöglichkeiten, um im Sommer erzeugten Strom für den Winter zu lagern): Diskriminierungsfreier Zugriff im Binnenmarkt; keine exklusive Nutzung mehr für den eigenen Winterbedarf. Reserven könnten an andere Marktteilnehmer fliessen, selbst wenn im Inland noch kein Reservebedarf besteht.
Keine Pflicht zur Öffnung nationaler Reserven (Möglichkeit, inländische Reserven exklusiv für den eigenen Bedarf vorzuhalten): Nationale Reserve bleibt möglich, muss aber EU-kompatibel sein; in der Praxis kann das bedeuten, dass Kapazitäten auch EU-weit zugänglich sein müssen, wodurch die exklusive Nutzung eingeschränkt wird.
III. Import- und Exportfähigkeit
Resilienz gegenüber Importausfällen (Fähigkeit, kurzfristige Ausfälle von Stromimporten durch Reserven oder schnelle Ersatzproduktion zu kompensieren): Heute kann die Schweiz Reserven und Importquellen exklusiv für den Eigenbedarf priorisieren. Mit dem Stromabkommen vertraglich diskriminierungsfreier Zugang zu Kapazitäten im Binnenmarkt; fällt z. B. Frankreich als Lieferland aus, sollen andere Nachbarn einspringen. Krisenautonomie sinkt, Problem unsicherer Grenzkapazitäten wird teilweise entschärft.
Grenzkapazitäten (Menge an Strom, die über die Landesgrenzen transportiert werden kann, und wer darüber entscheidet): Heute nationale Priorisierung möglich, künftig zentrale EU-Zuteilung; soll laut Bundesrat auch in Krisen die Verfügbarkeit sichern. Versprechen hängt direkt mit Importresilienz zusammen – ohne ausreichende Kapazitäten verpufft der Vorteil.
IV. Steuerung in Krisen
Unabhängige Importpriorisierung (Freiheit, im Engpassfall zu entscheiden, aus welchen Ländern Strom zuerst importiert wird): Heute freie Wahl der Lieferländer im Engpassfall. Mit Stromabkommen entfällt diese Möglichkeit, Verteilung nach Binnenmarktregeln. Flexibilität geht verloren, auch wenn einzelne Quellen für die Schweiz vorteilhafter wären.
Kritische Infrastruktur- und Steuerungshoheit (Entscheidungsfreiheit, welche lebenswichtigen Bereiche im Krisenfall mit Strom versorgt werden): Krisenversorgung unterliegt EU-Koordinierung; keine alleinige Entscheidungshoheit mehr.
Direkte bilaterale Lieferverträge (Möglichkeit, unabhängig von EU-Regeln Stromlieferungen mit einzelnen Ländern oder Versorgern zu vereinbaren): Heute eigenständige Priorisierung lebenswichtiger Systeme wie Kommunikation, Gesundheit, Wasser, Verkehr oder Sicherheit. Mit Stromabkommen Teil der EU-Notfallkoordination; nationale Prioritäten könnten zurückstehen.
V. Wirtschaftliche und politische Autonomie
Freie Gestaltung nationaler Fördermodelle (Freiheit, eigene Subventionen und Förderungen für erneuerbare Energien festzulegen): Heute frei wählbar, etwa Einspeisevergütungen oder Investitionsbeiträge. Mit Stromabkommen nur noch EU-beihilferechtlich kompatible Modelle möglich.
Preissetzung im Land (Kontrolle darüber, wie Strompreise im Inland gebildet und beeinflusst werden): Heute direkte Steuerung über Marktregeln, Tarife und Abgaben möglich. Mit Stromabkommen stärkere Beeinflussung durch EU-Marktmechanismen; weniger Spielraum für gezielte Preisstabilisierung.
Dieses Paket bricht mit der direkten Demokratie.
Das Paket Schweiz-EU stellt die direkte Demokratie der Schweiz in Frage. Nach dem EWR-Nein und dem Abbruch des Rahmenabkommens soll mit dem Paket Schweiz-EU jetzt alles anders sein. Wir sehen das nicht so und sagen: Es reicht! Und wir erklären, warum.
(c) 2015: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Paket Schweiz-EU: Time-out bitte.
Die Vernehmlassung zum Paket Schweiz–EU ist angelaufen. Ein positives Zeichen, denn die Diskussionen sind engagiert und erzeugen Resonanz. Die institutionelle Anbindung rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen. Eine Klärung würde der Vernehmlassung gut tun. Der vorliegende Artikel liefert den Anstoss dazu.
(c) 2013: Monte Generoso, Capolage, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz.
Das Paket Schweiz-EU würde unser Land grundlegend und unwiderruflich verändern. Es geht um die Frage wer künftig unser Recht bestimmt, Brüssel oder wir. Zum 1. August 2025 mein Appell: Mischen Sie sich ein. Unsere Heimat gehört den Menschen nicht der Politik. Ein Blick auf die FDP zeigt warum.
(c) 2017: Capanna Monte Bar, Capriasca, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Das Stromabkommen im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit.
Das neue Stromabkommen (Elektrizität) im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit ist ein zentrales Element des Pakets Schweiz–EU. Es offenbart im Perspektivenwechsel ein unerwartetes Ausmass an gegenläufigen Erwartungen der Vertragspartner. Wer eintauchen will, dieser Artikel ist die richtige Gelegenheit dazu.
(c) 2019: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Orginalwortlaut Stromabkommen - hier online verfügbar.
Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? Wir haben die 163 Seiten des Stromabkommens ordentlich strukturiert und im Originalwortlaut der EU auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Wir leisten damit einen Beitrag zur Lesbarkeit dieses Abkommens. Wir hoffen, dass viele so einen einfacheren Zugang dazu finden und unser Angebot nützlich ist.
Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint.
Ein umfassendes Paket von Abkommen zur Festigung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt jetzt auf dem Tisch. Es bildet die Grundlage für eine folgenschwere Entscheidung der Schweiz, die es ernsthaft auszuloten gilt.
(c) 2025, Schloss Wildegg, Möriken-Wildegg, Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser.
Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.
Hier finden Sie die Stellungnahme von smartmyway zum Paket Schweiz-EU im Rahmen der offiziellen Vernehmlassung.
(c) 2016: Gewittersturm, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
smartmyway unterwegs.
(c) 2017: Lisone, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.
Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management