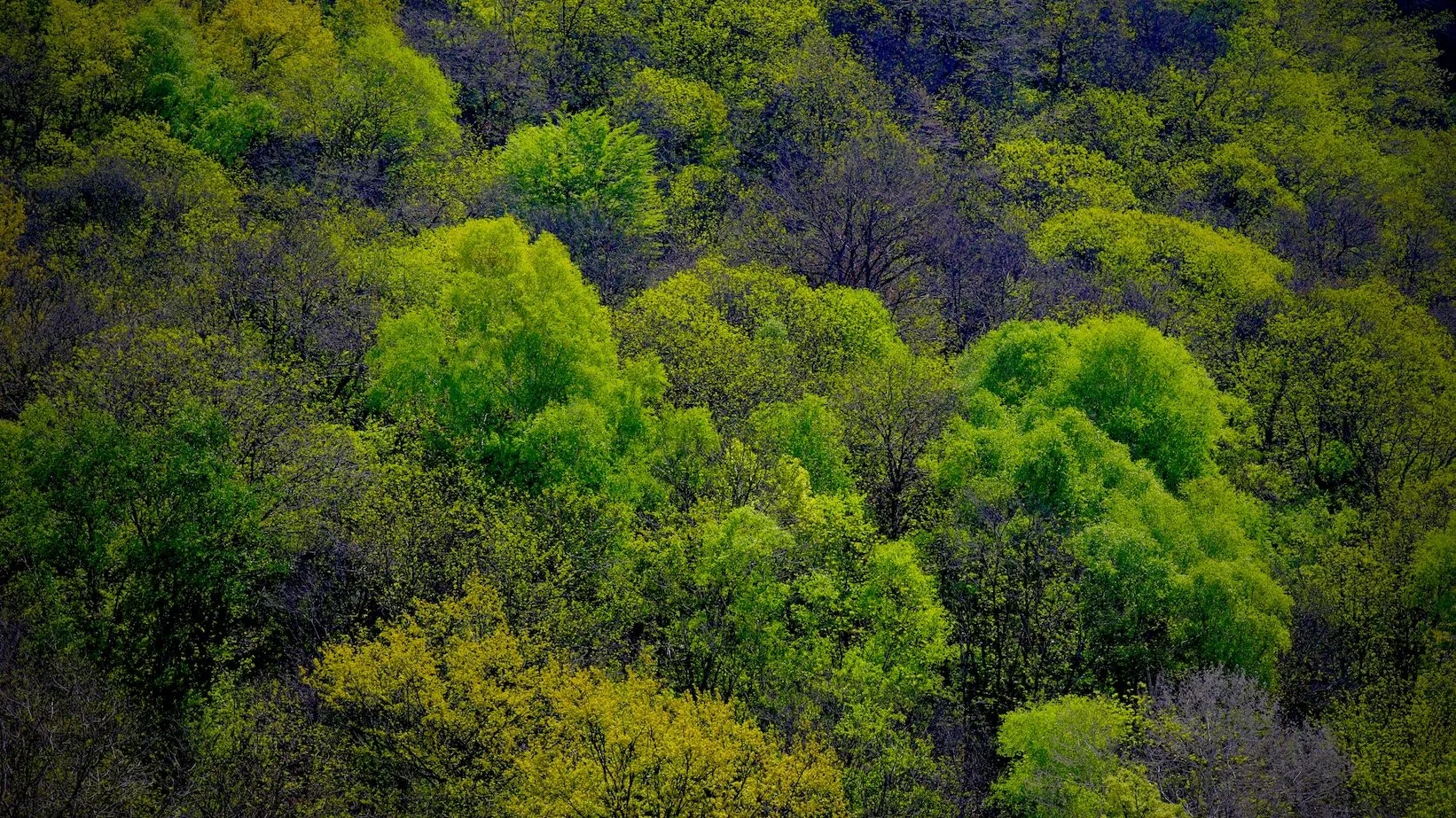Dieses Paket bricht mit der direkten Demokratie.

Das Paket Schweiz-EU stellt die direkte Demokratie der Schweiz in Frage. Nach dem EWR-Nein und dem Abbruch des Rahmenabkommens soll mit dem Paket Schweiz-EU jetzt alles anders sein. Wir sehen das nicht so und sagen: Es reicht! Und wir erklären, warum.
Langsam verstehen wir das Paket Schweiz-EU. Seine Struktur haben wir erfasst und mit seiner institutionellen Anbindung jenen Punkt identifiziert, der über das Vertragswerk entscheiden wird. Auch liegt die Pro-Argumentation offen, die nahtlos die Texte des Bundesrates zitiert, der seinerseits das Paket zur Annahme empfiehlt. Also nichts Überraschendes.
Beim Stromabkommen schauen wir derzeit genauer hin. Wir haben die Wirkungsweise seiner dynamischen Übernahme von EU-Recht verstanden (nach der sogenannten Integrationsmethode). Wir wissen auch, dass die in seinem Anhang I aufgeführten 20 EU-Rechtsakte unmittelbar nach Paketannahme auch auf Schweizer Hoheitsgebiet gelten würden. Es ist uns jetzt klar, dass damit zusätzliche 796 Seiten EU-Gesetzestexte direkt von Schweizer Einwohnerinnen und Einwohner und Schweizer Firmen befolgt werden müssten.
Das hat uns stutzig gemacht. Das Ganze ist übermächtig geworden und kaum mehr vollumfänglich erfassbar. Wir fragen uns, was in den anderen Abkommen noch folgt und was ausserdem die Beamten der Schweiz die letzten Jahre schon umgesetzt haben und jetzt gerade im Begriff zu tun sind. Was ist das ganze Ausmass dieser massiven Rechtsübernahme? Wir wissen es nicht und können es faktisch auch nicht wissen.
Wir fragen uns allerdings, was jetzt noch kommt, denn es scheint ausser Kontrolle zu geraten. Der folgende Artikel zeigt, was auf dem Spiel steht.
Roland Voser, 8. August 2025
Hier finden Sie die Online-Quellen für folgende Themen: Vertragstext Freizügigkeitsabkommen, Vertragstext Stromabkommen, Lesehilfe EDA-Dokumente
Es reicht!
Wer sich die letzten Wochen tatsächlich mit dem Paket Schweiz-EU auseinandergesetzt hat, erkennt in diesen Tagen seine wahre Tragweite. Hinter den Papierbergen wird zunehmend klar und stützt unsere These: Die institutionelle Logik dieses Pakets führt langfristig in Richtung EU-Beitritt, und zwar unabhängig von der öffentlich geäusserten Absicht der Befürworter.
Dies geschieht ohne sachlichen Zwang. Die Beweggründe der Macher bleiben diffus. Vielleicht spielen persönliche oder ideologische Motive eine Rolle. Möglicherweise dominiert die Vorstellung, dass sich die Schweiz langfristig ohnehin in die EU integrieren müsse. Sie sagen zwar Nein zum EU-Beitritt, meinen aber Ja.
Fest steht: Dieser politische Kurs wurde seit über drei Jahrzehnten konsequent verfolgt. Heute zeigt sich, dass wie damals die Akteure in Verwaltung oder Politik noch immer dasselbe Ziel verfolgen. Bereits 1992 war der zentrale Grund für die Ablehnung des EWR am 6.12.1992 die vorgesehene Übernahme von EU-Recht ohne verbindliche Mitsprache bzw. Mitbestimmung. Genau diesen Mechanismus enthält das Paket Schweiz-EU erneut, diesmal unter dem Begriff der Integrationsmethode (siehe Link).
Ironischerweise war es nach dem EWR-Nein die EU selbst, die mit dem bilateralen Weg der Schweiz eine Alternative ermöglichte, und dies in der Erwartung, dass sich die Schweiz auf diesem Weg ohnehin früher oder später in die EU integrieren würde. Gerade dieser bilaterale Weg entwickelte sich tatsächlich zu einer Erfolgsgeschichte. Die Schweiz ist heute ein bedeutender Handelspartner der EU und liegt bei deren Importstatistik auf Platz vier, nach den USA, China und Grossbritannien. Umgekehrt ist die EU die wichtigste Handelspartnerin der Schweiz.
Trotzdem wiederholte sich später die Geschichte. Auch beim Rahmenabkommen, das 2021 scheiterte, waren neben dem Lohnschutz und der Unionsbürgerrichtlinie wiederum die dynamische Rechtsübernahme und der Europäische Gerichtshof als abschliessende Instanz die massgebenden Bruchstellen für den Vertrag. Der Bundesrat hatte darauf konsequenterweise die Verhandlungen abgebrochen.
Nun liegt das Paket Schweiz-EU mit denselben Grundelementen wieder vor. Ohne dass sich an der institutionellen Problematik etwas substanziell geändert hätte. Und der Bundesrat empfiehlt das Paket dieses Mal zur Annahme. Doch es ist offensichtlich: Die Zielrichtung wurde nicht angepasst. Die vertraglichen Architekten bleiben ihrem institutionellen Entwurf treu. Man könnte auch «unbeeindruckt von bisherigen Ablehnungen» dazu sagen, doch sie folgen konsequent ihrem Ziel des Beitritts der Schweiz zur Europäischen Union. Der Bundesrat hat nun die Seiten gewechselt und empfiehlt heute das Paket Schweiz-EU zur Annahme.
Ein Blick auf die Energiepolitik zeigt ein ähnliches Muster.
Ein vergleichbares Vorgehen war bereits bei der Energiestrategie 2050 zu beobachten. Auch dort wurde ein grundlegender Systemwechsel nicht als solcher vervollständigt. Wesentliche Teile wie saisonale Speicher, Ablösung der Fossilen, zunehmender Strombedarf, jahrzehntelange Importabhängigkeit wurden unterschätzt oder blieben unberücksichtigt. Obwohl Fachleute in ihren nachträglichen Einschätzungen der Strategie erhebliche Defizite bescheinigen, bleiben die Befürworter noch heute unbelehrbar.
Entscheidend ist, dass mit diesem Vorgehen jedoch neue Tatsachen geschaffen wurden, die unumkehrbar sind. Auch unvollständig wurde der Point-of-no-return erreicht, nach dem es kein Zurück mehr gibt. Die Befürworter verfolgten eine politische Vision und haben diese gegen die Mehrheit durchgesetzt. Sorge bereitet, dass ein solches Vorgehen unvollständig und risikoreich ist. So machen es auch Aktivisten, denen der Bestand letztlich egal ist und nichts bewahrt werden soll. Wir glauben, exakt dieses Muster nun im europapolitischen Kontext zu beobachten.
Das Paket tangiert substantiell die Eigenständigkeit der Schweiz.
Wenn das Paket Schweiz-EU zu 37 Prozent aus institutionellen Protokollen besteht, dann ist es in erster Linie ein institutionelles Vertragswerk und muss als solches beurteilt werden. Diese Diskussion müsste jetzt an erster Stelle geführt werden. Wir meinen, dass diese Auseinandersetzung offen, ehrlich, transparent, systematisch und mit voller demokratischer Legitimation erfolgen muss.
Dies bedeutet eine Volksabstimmung darüber, ob die Schweiz in Teilen EU-Recht auf ihrem Schweizer Hoheitsgebiet gültig machen soll, und zwar für alle Menschen und Firmen in der Schweiz. Über eine derartige Änderung der Bundesverfassung muss abgestimmt werden.
Wenn etwa das Stromabkommen mit seinen 163 Seiten in seinem Anhang I zusätzlich 796 Seiten EU-Recht enthält, die nach Annahme verbindlich und ohne faktisch wirksame Mitbestimmung von Parlament oder Volk auf Schweizer Hoheitsgebiet für Menschen und Firmen gelten sollen, dann handelt es sich um eine tiefgreifende Rechtsübernahme. Das nationale Recht wird durch supranationales Recht ersetzt. Die Fähigkeit der Schweiz, eigenständig Gesetze zu setzen, wird eingeschränkt. Das entspricht nicht mehr und nicht weniger als einer existentiellen Veränderung des Schweizer Rechtssystems.
Die gleiche Integrationsmethode kommt auch für das Freizügigkeitsabkommen, das Luftverkehrsabkommen und das Lebensmittelsicherheitsabkommen sowie beim Gesundheitsabkommen zur Anwendung. Es ist heute unklar, über welchen Umfang von EU-Recht wir gesamthaft sprechen. Wir bezweifeln, dass selbst der Bundesrat und seine Verwaltung heute einen vollständigen Überblick über den Umfang des betroffenen EU-Rechts besitzen.
Wir kommen zu einem klaren Schluss: Dieses Konzept widerspricht Artikel 2 Absatz 1 der Bundesverfassung. Es ist nicht damit vereinbar. Dort heisst es:
«Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes.»
Der Bundesrat verstösst unseres Erachtens mit dem Paket Schweiz-EU gegen diese Bestimmung.
Doch – es benötigt ein Ständemehr.
Artikel 140 regelt das obligatorische Referendum. In Absatz 1 hält er fest, dass Änderungen der Bundesverfassung dem Volk und den Ständen zur Abstimmung unterbreitet werden müssen:
«Dem Volk und den Ständen zur Abstimmung vorgelegt werden: a. die Änderung der Bundesverfassung; b. der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften; ...»
Die Bedeutung dieser Vorschrift ist eindeutig: Wenn ein institutioneller Umbau dieser Tragweite bevorsteht, müssen sowohl das Volk als auch die Kantone zustimmen. Ein einfaches Volksmehr reicht nicht.
Der Bundesrat hat sich am 30. April 2025 jedoch für ein fakultatives Referendum ausgesprochen, das nur ein einfaches Mehr erfordert.
Damit verstösst er unseres Erachtens gegen Artikel 140 der Bundesverfassung.
Besondere Aufmerksamkeit verdient Artikel 190 BV.
Dieser Artikel lautet:
«Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend.»
Mit der Annahme der Verträge erhält der Bundesrat über Artikel 190 und dem völkerrechtlichen Status des Pakets Schweiz-EU die rechtliche Möglichkeit, künftiges EU-Recht automatisch auch für die Schweiz verbindlich zu machen. Die regulären Gesetzgebungsprozesse würden umgangen. Das Bundesgericht wäre verpflichtet, das völkerrechtlich gültige EU-Recht anzuwenden, selbst wenn es inhaltlich im Widerspruch zur Bundesverfassung steht.
Aus unserer Sicht ist es nicht hinnehmbar, dass der Bundesrat Parlament und Souverän nicht verständlich und transparent über diese Zusammenhänge informiert.
Damit legitimiert unseres Erachtens der Bundesrat sein Paket im Nachgang über Artikel 190 auch gegen die Bundesverfassung.
Daraus ergeben sich für uns drei klare Schlussfolgerungen.
Es sind:
Der Bundesrat versucht, ein intransparentes Vertragswerk trotz verfassungsrechtlicher Bedenken rasch durch den Gesetzgebungsprozess zu bringen und missachtet unseres Erachtens Artikel 2 BV.
Er missachtet unseres Erachtens eindeutig die Anforderungen von Artikel 140 BV und plant aus strategischem Eigeninteresse eine Abstimmung mit abgesenkter Hürde.
Er nutzt unseres Erachtens Artikel 190 BV unstatthaft, um völkerrechtlich verbindliches EU-Recht dauerhaft und ohne Mitwirkung der Bevölkerung zu verankern.
Diese Vorgehensweise wirft grundlegende Fragen auf, die wir so nicht länger im Raum stehen lassen können.
Deshalb ist der Zeitpunkt jetzt entscheidend.
Artikel 190 BV macht deutlich: Nach der Abstimmung ist eine Korrektur nicht mehr möglich, denn es bliebe faktisch nur die Kündigung des Abkommens. Nur im Vorfeld kann der verfassungsrechtliche Rahmen gesichert werden. Der Zeitpunkt für Transparenz ist jetzt und nicht erst im Nachhinein.
Wir fordern daher eine offene Klärung. Die institutionelle Dimension dieses Vertragswerks muss auf den Tisch. Und die Bevölkerung muss in einer Form entscheiden können, die der Bedeutung dieses Pakets gerecht wird.
Unser Standpunkt umfasst zwei Optionen und zwei Forderungen.
Der Bundesrat hat nun zwei Möglichkeiten:
Entweder wird die Integrationsmethode nachverhandelt und mit einem uneingeschränkten Vetorecht der Schweiz ausgestattet («Veto ohne Wenn und Aber»)
oder das Paket Schweiz-EU wird dem Souverän etappiert vorgelegt. Zuerst die institutionelle Anbindung in einem obligatorischen Referendum mit Volks- und Ständemehr. Im Anschluss die bestehenden Abkommen (z.B. Freizügigkeitsabkommen) sowie in einer dritten Abstimmung die neuen Abkommen (z.B. Stromabkommen).
Weiter erwarten wir:
Die sofortige Bereitstellung des gesamten Pakets Schweiz-EU inklusive der vollständigen bestehenden Abkommen (Änderungsprotokolle durch aktualisierte Vertragstexte der ursprünglichen Abkommen ergänzt) sowie des sämtlichen EU-Rechts, das mit der Integrationsmethode künftig gültig sein soll sowie ergänzend jenes EU-Recht, das mit dem Äquivalenzansatz ins Schweizer Recht übernommen werden muss.
Eine unabhängige Expertise dreier Fachexperten mit unterschiedlicher Haltung (pro, contra, neutral) zur institutionellen Anbindung der Schweiz aufgrund des Pakets Schweiz-EU und deren direkte und indirekte Konsequenzen auf die direkte Demokratie sowie innere Stabilität, Wohlstand und Fortschritt der Schweiz.
Ein Sensorium für Souveränität ist keine Überreaktion.
Wir halten es für falsch, das Sensorium für Souveränität als schweizerischen Reflex und rückständig abzutun. Dieses Sensorium hat bei uns in den letzten Wochen in Bezug auf dieses Paket laufend angeschlagen. Wir sind erstaunt über den unsorgfältigen Umgang mit dieser institutionellen Frage, wie bei uns durch dieses Paket und das Vorgehen dazu der Eindruck erweckt wird.
Wir halten es gerade daher für falsch, weil wir in der Welt sehen, wie schnell repräsentative Demokratien kippen. In den USA regiert heute Donald Trump faktisch durch. In Deutschland ist der politische Prozess blockiert, weil am Schluss die Machtpolitik der Parteiblöcke vor Vernunft und dem Wohl des Landes steht.
Die direkte Demokratie ist unser Schutzmechanismus gegen Staatswillkür. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist der Schutz der Menschen gegen den Staatsapparat. Die direkte Demokratie ist keine Folklore, sondern zwingt Regierung und Parlament zum laufenden Rechenschaftsbericht gegenüber dem Volk. Das ist unser Sicherheitsventil, das mit dem Paket Schweiz-EU jetzt neutralisiert werden soll.
Der Informationsstand ist unzureichend. Der Vertrauensverlust ist jetzt real. Bundesrat und Verwaltung hinterlassen grosse Fragezeichen mit ihrem Paket Schweiz-EU, weil sie die direkte Demokratie aus unserer Sicht in Frage stellen. Das ist gesellschaftspolitisch nicht tragbar und unseres Erachtens der vollständig falsche Ansatz. Es braucht eine umfassende und sorgfältige Nacharbeit, und zwar rasch.
Die direkte Demokratie erlaubt auch uns, an dieser Vernehmlassung teilzunehmen. Es ist das erste Mal, dass wir es tatsächlich auch tun. Sonst genügt unser Vertrauen ins System, dass es jeweils gut kommen wird. Es ist ja so: Es ist nicht entscheidend, Recht auszuüben. Es ist entscheidend zu wissen, dass man es tun könnte.
Für diese Sicherheit stehen wir ein. Und lehnen den Apfel der Versuchung ab.
Anhang: Die Artikel der Bundesverfassung im Wortlaut.
1 Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes.
2 Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes.
3 Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern.
4 Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung.
1 Die politischen Rechte sind gewährleistet.
2 Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe.
Art. 121a Steuerung der Zuwanderung
1 Die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig.
2 Die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz wird durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente begrenzt. Die Höchstzahlen gelten für sämtliche Bewilligungen des Ausländerrechts unter Einbezug des Asylwesens. Der Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt, auf Familiennachzug und auf Sozialleistungen kann beschränkt werden.
3 Die jährlichen Höchstzahlen und Kontingente für erwerbstätige Ausländerinnen und Ausländer sind auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz unter Berücksichtigung eines Vorranges für Schweizerinnen und Schweizer auszurichten; die Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind einzubeziehen. Massgebende Kriterien für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen sind insbesondere das Gesuch eines Arbeitgebers, die Integrationsfähigkeit und eine ausreichende, eigenständige Existenzgrundlage.
4 Es dürfen keine völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden, die gegen diesen Artikel verstossen.
5 Das Gesetz regelt die Einzelheiten.
1 Der Bund hält seine Ausgaben und Einnahmen auf Dauer im Gleichgewicht.
2 Der Höchstbetrag der im Voranschlag zu bewilligenden Gesamtausgaben richtet sich unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage nach den geschätzten Einnahmen.
3 Bei ausserordentlichem Zahlungsbedarf kann der Höchstbetrag nach Absatz 2 angemessen erhöht werden. Über eine Erhöhung beschliesst die Bundesversammlung nach Artikel 159 Absatz 3 Buchstabe c.
4 Überschreiten die in der Staatsrechnung ausgewiesenen Gesamtausgaben den Höchstbetrag nach Absatz 2 oder 3, so sind die Mehrausgaben in den Folgejahren zu kompensieren.
5 Das Gesetz regelt die Einzelheiten.
Art. 140 Obligatorisches Referendum
1 Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet:
a. die Änderungen der Bundesverfassung;
b. der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften;
c. die dringlich erklärten Bundesgesetze, die keine Verfassungsgrundlage haben und deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt; diese Bundesgesetze müssen innerhalb eines Jahres nach Annahme durch die Bundesversammlung zur Abstimmung unterbreitet werden.
2 Dem Volk werden zur Abstimmung unterbreitet:
a. die Volksinitiativen auf Totalrevision der Bundesverfassung;
b. die Volksinitiativen auf Teilrevision der Bundesverfassung in der Form der allgemeinen Anregung, die von der Bundesversammlung abgelehnt worden sind;
c. die Frage, ob eine Totalrevision der Bundesverfassung durchzuführen ist, bei Uneinigkeit der beiden Räte.
Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend.
Paket Schweiz-EU: Time-out bitte.
Die Vernehmlassung zum Paket Schweiz–EU ist angelaufen. Ein positives Zeichen, denn die Diskussionen sind engagiert und erzeugen Resonanz. Die institutionelle Anbindung rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen. Eine Klärung würde der Vernehmlassung gut tun. Der vorliegende Artikel liefert den Anstoss dazu.
(c) 2013: Monte Generoso, Capolage, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz.
Das Paket Schweiz-EU würde unser Land grundlegend und unwiderruflich verändern. Es geht um die Frage wer künftig unser Recht bestimmt, Brüssel oder wir. Zum 1. August 2025 mein Appell: Mischen Sie sich ein. Unsere Heimat gehört den Menschen nicht der Politik. Ein Blick auf die FDP zeigt warum.
(c) 2017: Capanna Monte Bar, Capriasca, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Das Stromabkommen im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit.
Das neue Stromabkommen (Elektrizität) im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit ist ein zentrales Element des Pakets Schweiz–EU. Es offenbart im Perspektivenwechsel ein unerwartetes Ausmass an gegenläufigen Erwartungen der Vertragspartner. Wer eintauchen will, dieser Artikel ist die richtige Gelegenheit dazu.
(c) 2019: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Orginalwortlaut Stromabkommen - hier online verfügbar.
Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? Wir haben die 163 Seiten des Stromabkommens ordentlich strukturiert und im Originalwortlaut der EU auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Wir leisten damit einen Beitrag zur Lesbarkeit dieses Abkommens. Wir hoffen, dass viele so einen einfacheren Zugang dazu finden und unser Angebot nützlich ist.
Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint.
Ein umfassendes Paket von Abkommen zur Festigung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt jetzt auf dem Tisch. Es bildet die Grundlage für eine folgenschwere Entscheidung der Schweiz, die es ernsthaft auszuloten gilt.
(c) 2025, Schloss Wildegg, Möriken-Wildegg, Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser.
Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.
Hier finden Sie die Stellungnahme von smartmyway zum Paket Schweiz-EU im Rahmen der offiziellen Vernehmlassung.
(c) 2016: Gewittersturm, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
smartmyway unterwegs.
(c) 2015: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.
Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management