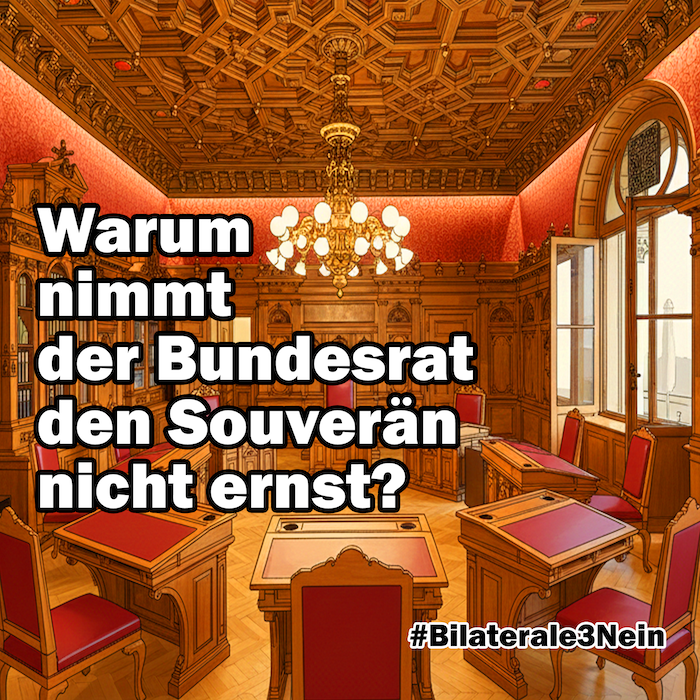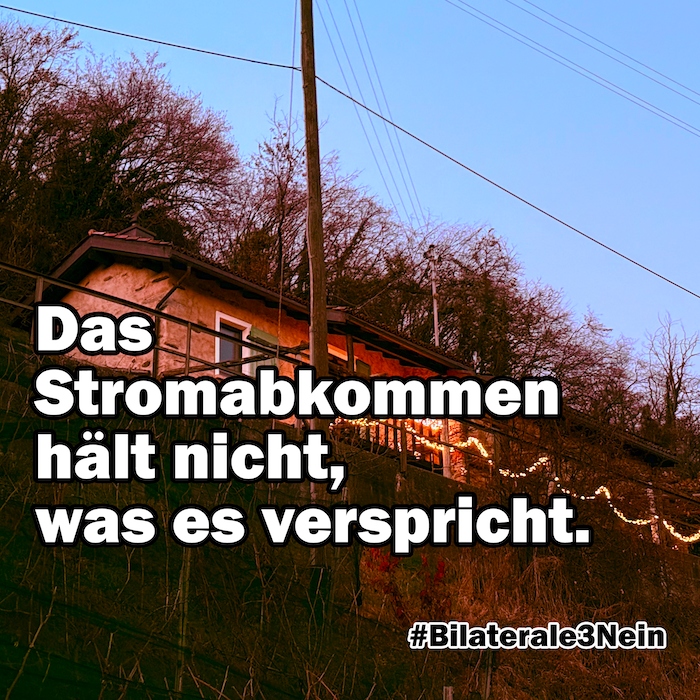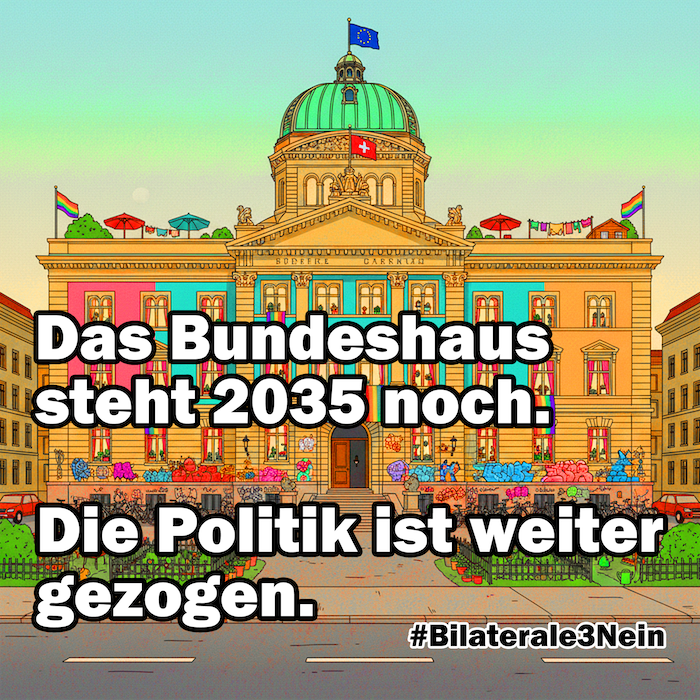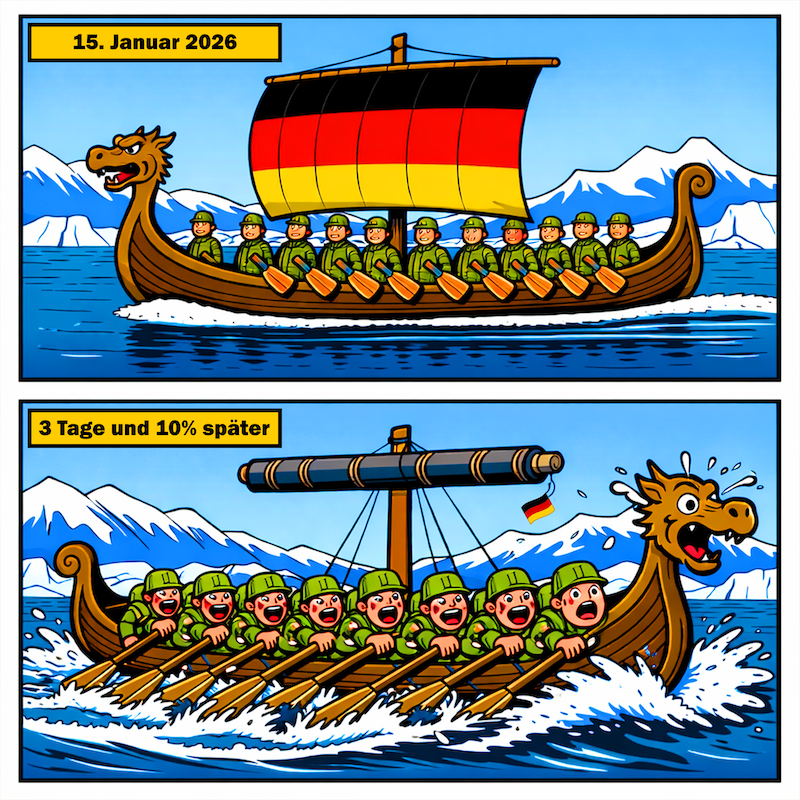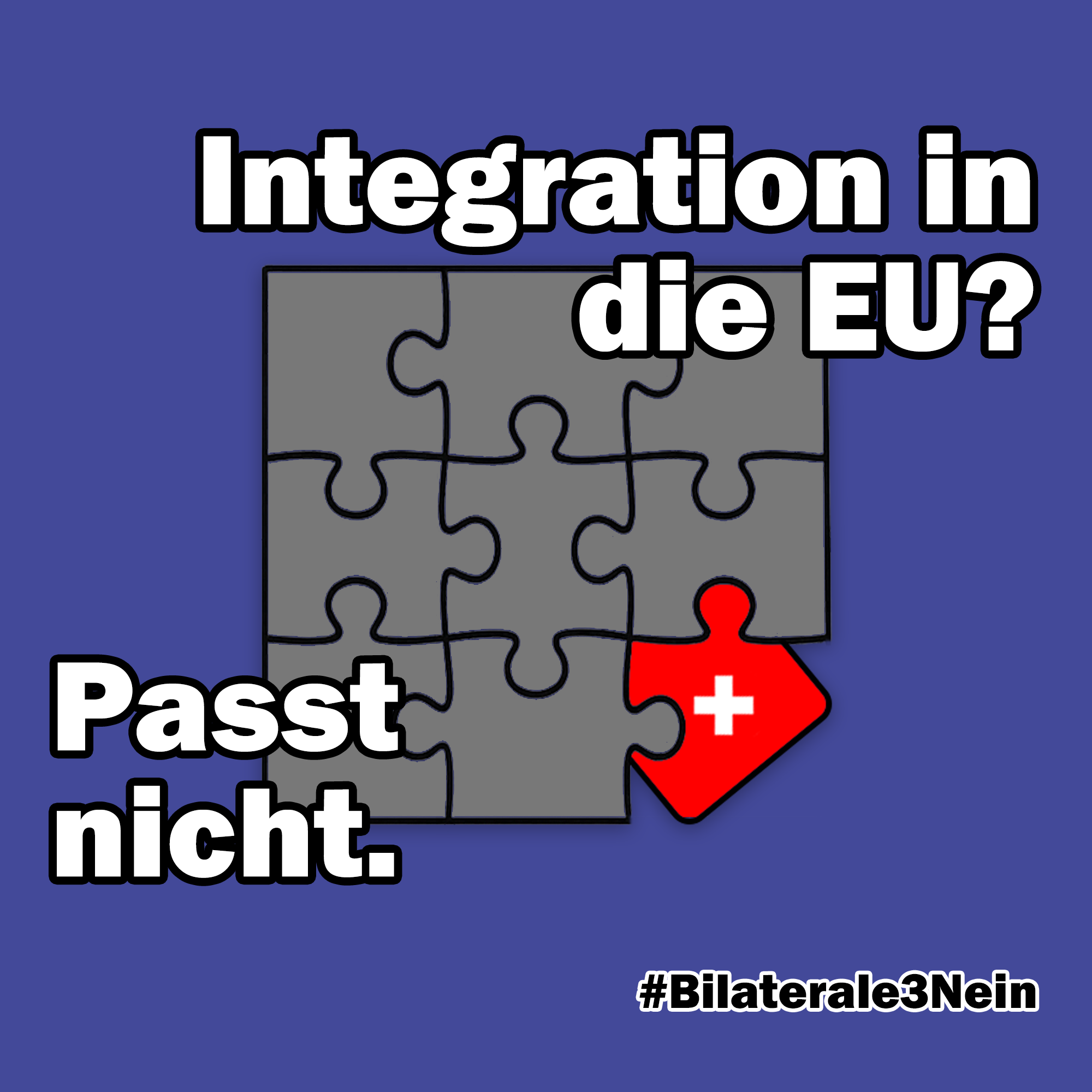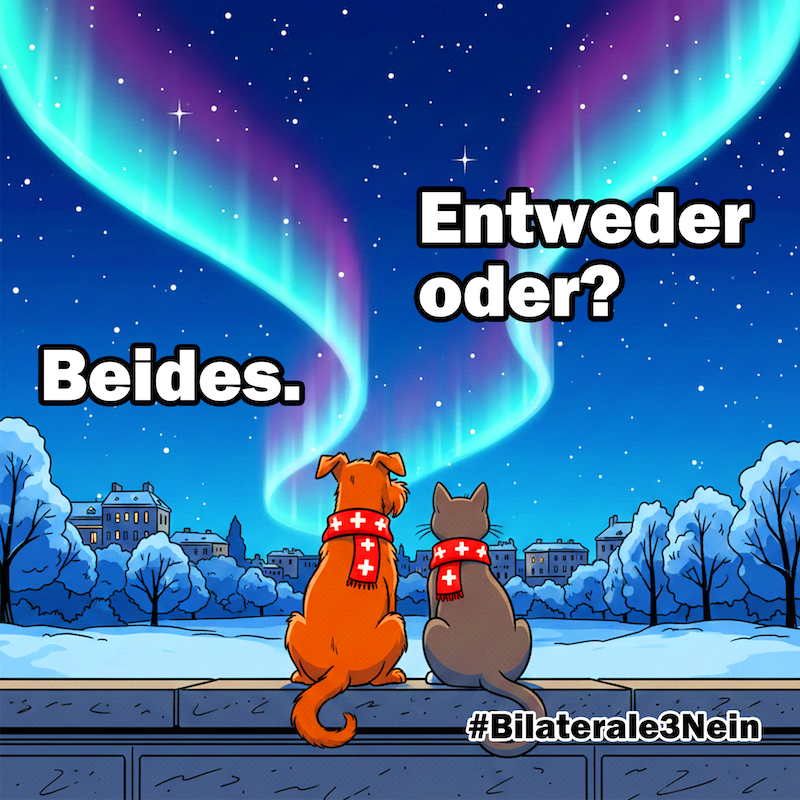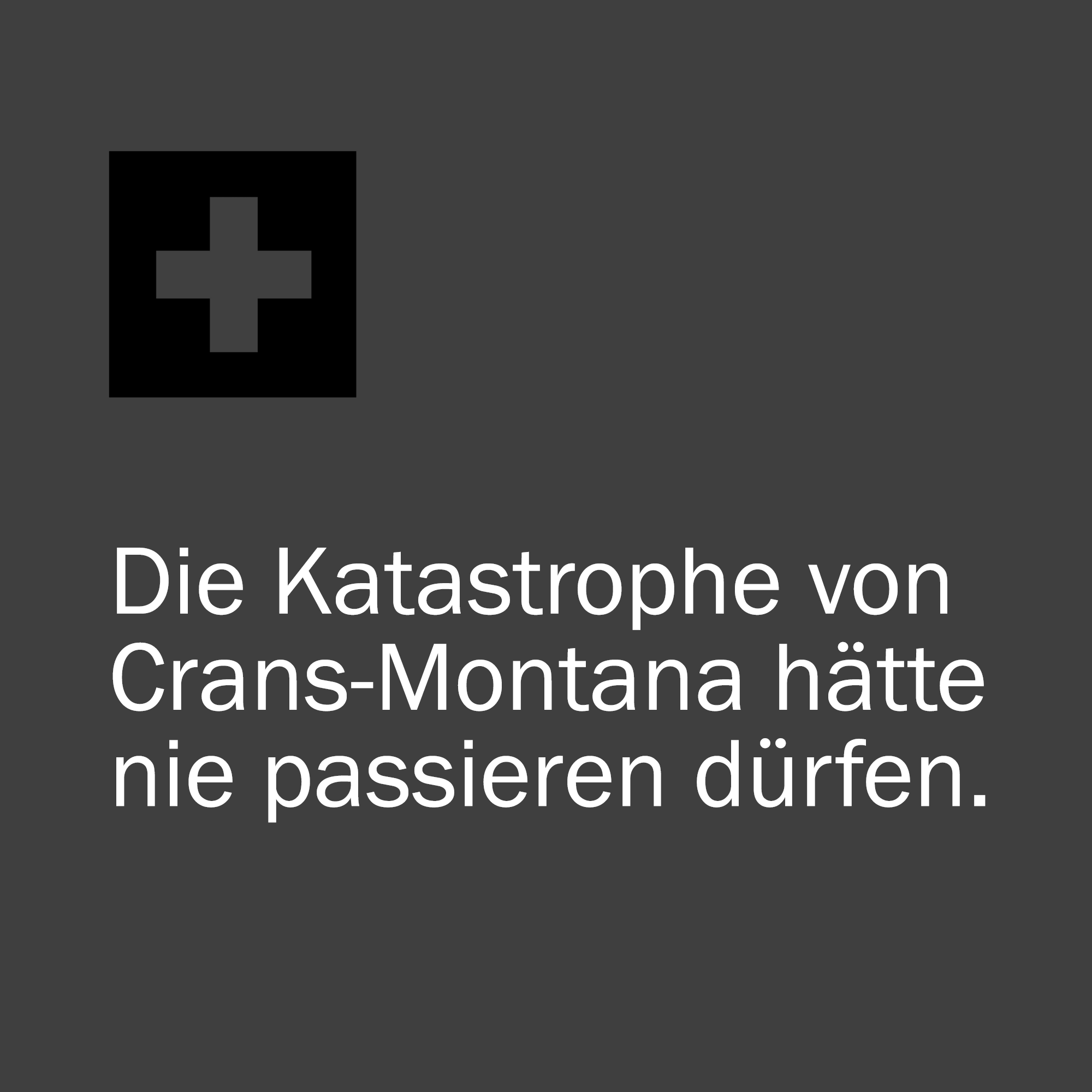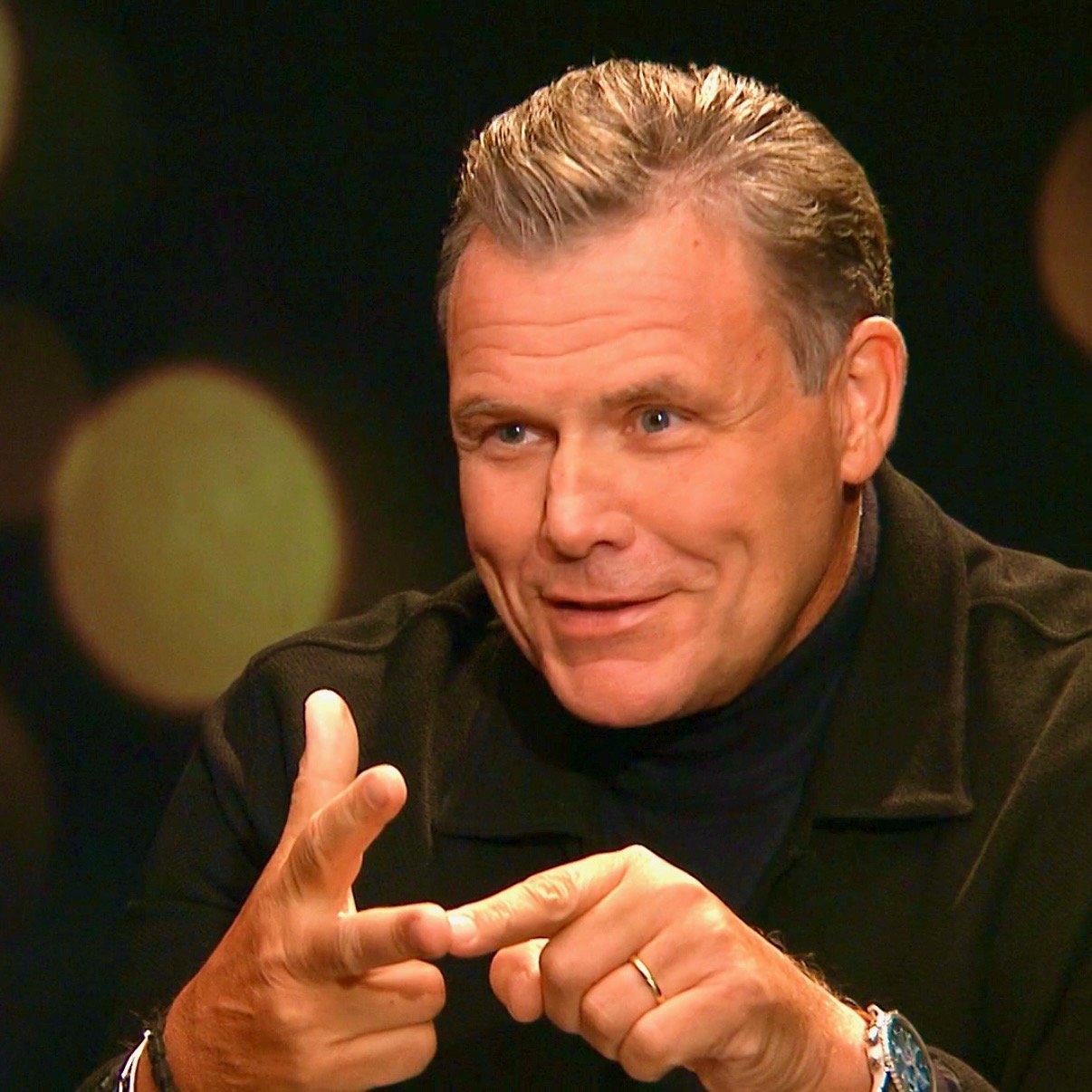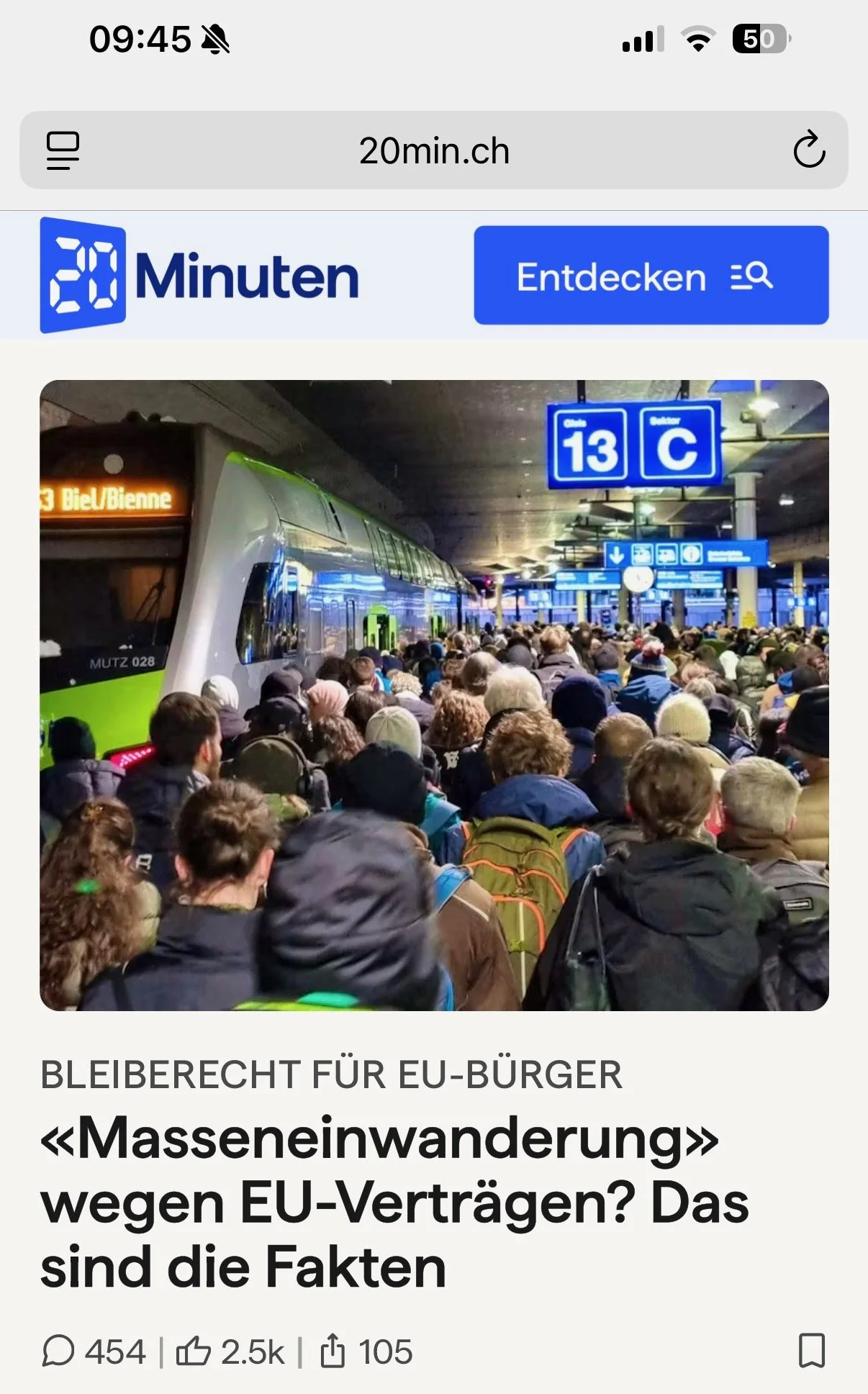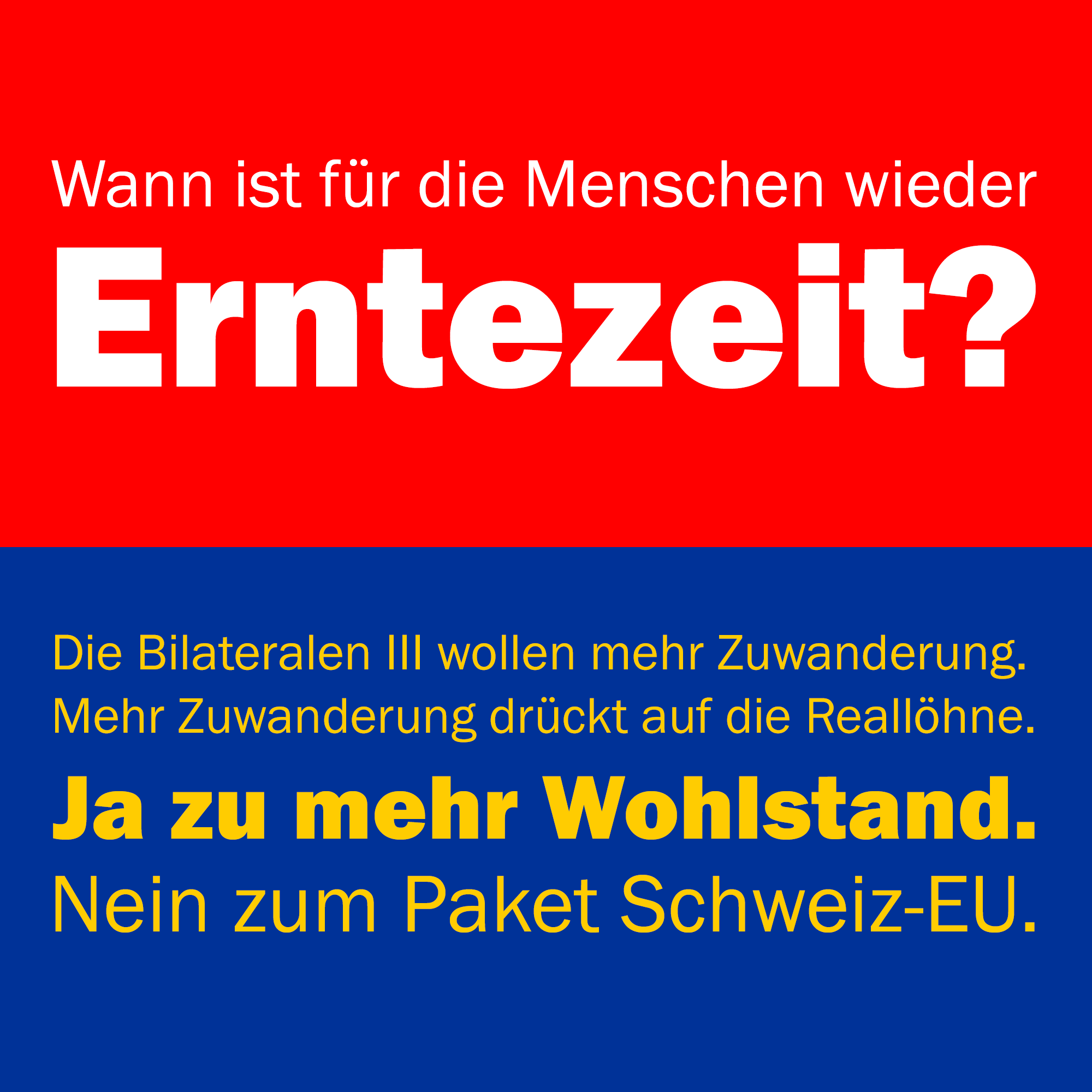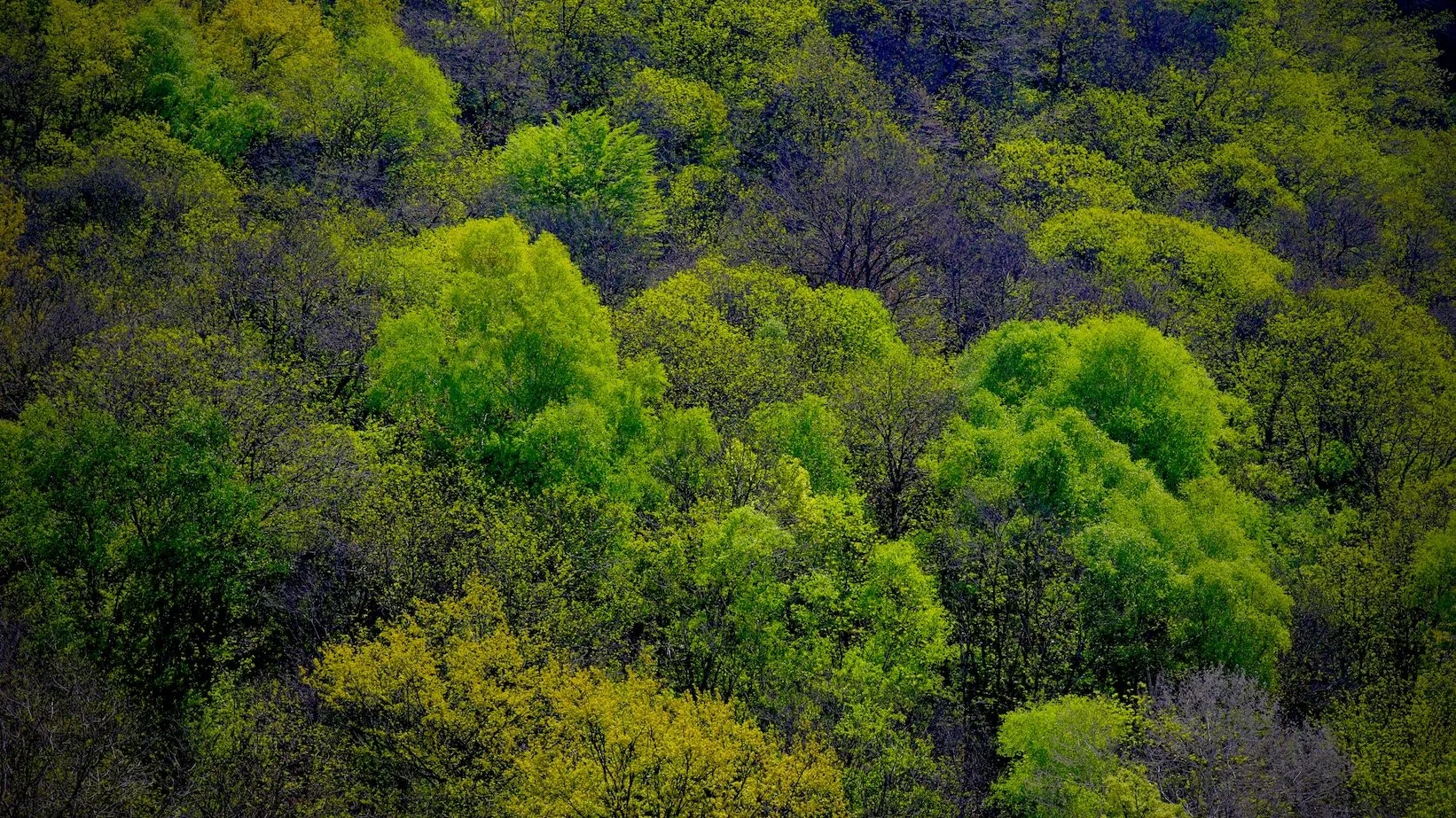Schweizsicht.

Die Sterne stehen für Tragweite, doch die Entscheidung fällt hier. Mit dem Paket Schweiz-EU steht unser Land vor einer existenziellen Zäsur. EU-Gesetze sollen gelten, ohne in einem Schweizer Gesetzbuch zu stehen. Ob wir das wollen, müssen wir selbst beurteilen. Die Regierung möchte es tun. Wir empfehlen es nicht. Die folgende Artikelserie liefert Ihnen die Begründung.
Die Sterne stehen für Tragweite, doch die Entscheidung fällt hier. Mit dem Paket Schweiz-EU steht unser Land vor einer existenziellen Zäsur. EU-Gesetze sollen gelten, ohne in einem Schweizer Gesetzbuch zu stehen.
Ob wir das wollen, müssen wir selbst beurteilen. Die Regierung möchte es tun. Wir empfehlen es nicht. Unsere Artikelserie liefert Ihnen die Begründung. Sie finden sie hier. Am Schluss des Artikels. Vorher finden Sie einzelne Themen, die wir punktuell veröffentlicht haben.
Aus Befürwortersicht ist das Argumentieren einfach. Die Informationen des Bundesrates liefern genügend Stoff. Doch bei dieser Vorlage ist in einer direkten Demokratie kein Absender stark genug, um nicht selbst den Blick in die Sterne zu tun.
Breite Zustimmung muss hinterfragt werden. Dies geschieht durch sachliche, faktenbasierte Kritik. Es ist die Schweizsicht, die zählt – nicht die EU-Sterne, mögen sie noch so verlockend scheinen, denn die Schweiz ist und bleibt kein Mitglied.
Wir hoffen, dass Sie unsere Impulse nützlich finden und freuen uns auf einen konstruktiven Austausch.
Roland Voser, 27. August 2025, letztmals ergänzt am 10. Januar 2026
Warum nimmt der Bundesrat den Souverän nicht ernst?
Sagen, was ist.
Der Bundesrat nimmt meines Erachtens bei den «Bilateralen III» den Souverän nicht ernst.
Kritik am Bundesrat mache ich ungern. Mir ist Harmonie wichtig und ich toleriere viel, um das gute Einverständnis mit den Mitmenschen nicht zu trüben. Auch weiss ich, dass die Aufgabe des Bundesrates nicht einfach ist.
Doch wir sollten nicht nur sagen, was sein soll. Sondern sagen, was ist. Rudolf Augstein (Gründer des Magazins Der Spiegel) und sein Sohn haben diese beiden Sätze einst geprägt.
Also sage ich hier, was ist:
Der Bundesrat nimmt den Souverän nicht ernst, weil er das Paket Schweiz-EU nicht ohne Wenn und Aber durch den Souverän bestätigen lassen will. Er wählt das fakultative Referendum: Ohne Unterschriftensammlung entscheidet das Parlament ohne Volk in einer Frage, die in diesem Jahrtausend von entscheidender Bedeutung für die Bürgerrechte ist.
Fakt ist, dass die Schweiz mit den «Bilateralen III» zukünftig nicht mehr alle ihre Gesetze selbst bestimmen kann: Mit Annahme des Pakets gelten die im Abkommen genannten EU-Verordnungen unmittelbar und ohne schweizerische Mitbestimmung auch in der Schweiz. Spätere Änderungen werden vorläufig angewendet. Will die Schweiz eine Änderung nicht übernehmen, drohen Ausgleichsmassnahmen.
Nicht bloss in einigen technischen Bereichen, sondern in den lebensrelevanten Sektoren Freizügigkeit, Luftverkehr, Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit.
Der Bundesrat hat sich auf den falschen Weg begeben. Er wird von weiten Teilen der Bevölkerung zunehmend nicht mehr verstanden. Diese Haltung widerspricht dem Sinn und Geist der Bundesverfassung. Sie belastet den Gesellschaftsvertrag zwischen gewählten Mandatsträgern und ihren Auftraggebern. Ich finde das besorgniserregend.
Ich beobachte einen empfindlichen Vertrauensbruch zwischen Regierung und Teilen des Souveräns: Die unnötige Polarisierung der Gesellschaft durch die «Bilateralen III» ist eine Folge davon. Das kann nicht im Interesse der Schweizer Regierung sein. Sie hat das Land zu einen, nicht zu teilen. Darüber müssen sich auch die anderen Befürworter der «Bilateralen III» im Klaren sein.
Man kann beim Paket Schweiz-EU materiell unterschiedlicher Meinung sein. Jedoch nicht beim obligatorischen Referendum. Dieses würde zwingend den Souverän über das Paket Schweiz-EU entscheiden lassen. Denn nur der Souverän kann seine eigenen Rechte einschränken. Niemand sonst.
So sehe ich das. Und Sie?
#Bilaterale3Nein
Datum: 26.1.2026 | Post: LinkedIn
Mein Kommentar:
Ihre Darstellung kann ich gut nachvollziehen. Man kann auch die Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative als Beispiel nehmen.
Bereits der Artikel 121a (die Schweiz steuert selbst die Zuwanderung) wäre nach gesundem Menschenverstand Grund genug, dieses Paket dem Ständemehr zu unterstellen. Das dazu relevante EU-Recht ist hier genügend klar.
Interessant ist allerdings, dass selbst Vertreter der KdK diesen Punkt (und einige weitere BV-Artikel) ignorieren und Kraft ihres Amtes tun und lassen, was sie für gut befinden. Was wiederum für das Land gefährlich ist.
Das hat mit Demokratie, Verfassung, Vertrauen und Fairness nichts zu tun. Es ist reine Machtpolitik, aus welchen Motiven auch immer. Nicht gegen aussen (was durchaus auch nötig sein kann), sondern gegen innen (was zu Zersetzung führt). Offenbar glauben aber diese Leute, dass es einfacher ist, sich gegen innen durchzusetzen.
Was allerdings jeweils nach Abstimmungen zu langen Gesichtern führen kann. (Link)
Das Stromabkommen hält nicht, was es verspricht.
Die NZZ hinterfragt das Stromabkommen erneut kritisch. Stromhändler hingegen meinen, dass das Stromabkommen zu tieferen Preisen führt. Wir fragen uns:
Wenn die Marktöffnung zu tieferen Preisen führt, warum braucht es dann im Abkommen eine Grundversorgungsausnahme für Haushalte?
Diese Ausnahme existiert, weil offenbar marktbasierte Preise für die Bevölkerung nicht zuverlässig funktionieren. Das ist ein Konstruktionsfehler des Binnenmarkts.
Das Stromabkommen und das Paket Schweiz-EU verfolgen andere Ziele: Als Integrationsprojekt geht es darum, wie die Schweiz einheitlich in den Strombinnenmarkt eingebunden werden soll. Das würde folgerichtig nach EU-Regeln erfolgen und den erwähnten Konstruktionsfehler für die Schweiz dauerhaft verankern.
Diese Regeln sind für die Schweiz nachteilig, weil sie nicht primär die Bedürfnisse unseres Landes berücksichtigen und damit lokale Gegebenheiten ausser Acht lassen. Sie setzen die Standortvorteile der Schweiz systematisch ausser Kraft.
So erfüllt das Stromabkommen auch im Krisenfall die Erwartungen nicht, weil zentrale Elemente wie die Zuteilung von Grenzkapazitäten für Stromlieferungen und Stromtransit nicht nach Schweizer Interessen, sondern nach EU-Gesamtinteressen erfolgen.
Vertreter aus Wirtschaft und Politik argumentieren aus ihrer jeweiligen Interessenlage. Das Stromabkommen beeinflusst staatseigene Stromproduzenten. Sie erhoffen sich Vorteile aus Handels- und Marktsicht. Analog gilt dies für die Unternehmer, die mit Marktzugangssicht argumentieren.
Diese Perspektiven gehören zum demokratischen Diskurs. Sie stellen unseres Erachtens jedoch nicht die Sicht der Bevölkerung dar. Für sie zählen tiefe Strompreise und Versorgungssicherheit.
Sie fragen nach der Alternative? Es ist die Aufgabe der Regierung, Abkommen auszuhandeln, die primär für die Bevölkerung vorteilhaft sind. Aber bestimmt nicht nachteilig. Unsere Aufgabe ist es, auf die kritischen Punkte hinzuweisen. Das tun wir hier und im beiliegenden Artikel.
#Bilaterale3Nein #StromabkommenNein
The center of the world is here.
Mit dieser Rede macht Donald J. Trump deutlich: Die Welt steht vor einer grundlegenden Neuordnung.
Die USA definieren ihre Rolle neu und halten ihre Erwartungen an ihre Partner unmissverständlich fest. Er betont glaubhaft die gemeinsamen kulturellen Werte als Grundlage für den Erfolg der USA und Europas. Er bedauert, «dass sich Europa selbst zerstöre.»
Zugleich soll die Einseitigkeit und «Undankbarkeit» in den Beziehungen zu Lasten der USA nicht länger Bestand haben. Mit Nachdruck fordert er die Übergabe von Grönland als Tatbeweis.
Unverändert beanspruchen die USA für sich das Zentrum der Welt.
Die Konsequenzen dieses von den USA initiierten Wandels sind noch nicht absehbar. Möglicherweise wurde heute ein Umbruch in der NATO eingeleitet. Auch die Reaktionen der in der Rede Vorgeführten bleiben abzuwarten.
Ist der amerikanische Präsident damit zu weit gegangen oder hat er in der Sache einfach recht?
Das Video ist sehenswert. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.
#Trump #Davos2026 #Geopolitics #WorldOrder #SpecialAddress #Greenland
Datum: 21.1.2026 | Post: LinkedIn
Das Bundeshaus steht 2025 noch.
Wir könnten auch mit dem Paket Schweiz-EU noch abstimmen. Aber Brüssel entscheidet, ob das Ergebnis akzeptiert wird oder ob wir dafür bestraft werden.
Diese Strafen nennt man «Ausgleichsmassnahmen». Sie stehen so in den institutionellen Protokollen der «Bilateralen III». Dazu hat der Bundesrat Ja gesagt.
Wenigstens könnte man das Bundeshaus in den nächsten Jahren umnutzen. Als neuen Wohnraum beispielsweise (siehe Bild). Das wäre vielleicht sinnvoller als ein Schattenparlament. Was meinen Sie?
#Bilaterale3Nein #DirekteDemokratieJa
Datum: 20.1.2026 | Post: LinkedIn
Grönland.
Was bestimmt die EU künftig eigentlich NICHT?
Welche relevanten Aspekte unserer Schweiz wird die EU künftig eigentlich nicht bestimmen? Direkt oder indirekt?
1. Unsere Gesetze?
2. Unsere Rechtsprechung?
3. Unsere Abstimmungen?
4. Unsere Stromversorgung?
5. Unseren Taktfahrplan?
6. Unsere Gesundheit?
7. Unsere Löhne & Renten?
8. Unsere Zuwanderung?
9. Unsere Lebensmittel?
10. Unseren Wohlstand?
11. Unsere Steuern?
12. Unser Land?
13. Unsere Zukunft?
Können Sie irgendwo mit Sicherheit mit Nein antworten? Wo ist verbindlich ausgeschlossen, dass diese Bereiche NICHT betroffen sein werden? Wer garantiert dies, und mit welcher Sicherheit?
Das ist das Problem des Pakets Schweiz-EU. Es ist kein kleines Update. Es wird die Schweiz in zu vielen relevanten Bereichen entscheidend verändern und sie strukturell dauerhaft in die EU integrieren. Es stellt aus unserer Sicht eine Zäsur dar, deren Konsequenzen wir heute nicht klar abschätzen können.
Das Risiko ist zu hoch. Also bleiben wir vernünftig und sagen NEIN dazu. Alles andere wäre naiv.
#Bilaterale3Nein #VernunftJa
Passt nicht.
Seit sieben Monaten macht es immer noch den Anschein, dass die «Bilateralen III» für die Schweiz institutionell nichts Entscheidendes ändern würden. Diese Sicht ist meines Erachtens nicht korrekt.
Mit diesem «Schweiz-Update» würden künftig 3’778 Seiten EU-Recht direkt in der Schweiz gelten. Verbindlich. Ohne Abbildung in einem Schweizer Gesetz.
Zum Vergleich: Die 55 wichtigsten Bundeserlasse der Schweiz inklusive Bundesverfassung umfassen rund 4’144 Seiten. Der Rechtsbestand auf Bundesebene würde sich damit faktisch auf einen Schlag verdoppeln.
Diese Gesetze stehen unter der Kontrolle der EU. Die Schweiz kann sich einbringen, aber nicht mitentscheiden. Und sie gelten für alle Privaten und Unternehmen. Unabhängig davon, ob sie exportieren oder nicht.
Betroffen sind entscheidende Binnenmarktsektoren: Freizügigkeit, Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit. In derselben Logik, wie sie im Luftverkehr bereits Realität ist.
Hat die Schweiz beim Luftverkehr profitiert? Ja, man kann von Zürich immer noch die wichtigen europäischen Destinationen anfliegen. Und Nein, die Swiss gehört heute der Lufthansa. Kleinere Anbieter sind unter dem Druck der Regulierung verschwunden. Der Werkplatz Schweiz hat verloren.
Die «Bilateralen III» verschieben die Macht nach Brüssel. Die Schweiz trägt die Folgen. Die Risiken sind zu wenig abschätzbar. Dafür riskieren wir nicht unser Erfolgsmodell. Also bleiben wir vernünftig und verzichten auf dieses Abenteuer.
#Bilaterale3Nein #UpdateNein #VernunftJa
Datum: 14.1.2026 | Post: LinkedIn
Unser Land.
Wie stark bestimmt die EU mit den «Bilateralen III» künftig unser Land? Es ist auch nach monatelangen Diskussionen nicht eindeutig.
Wir von smartmyway haben die Abkommen analysiert und unsere Erkenntnisse in unserer Vernehmlassungsantwort an den Bundesrat festgehalten (siehe Kommentare). Dabei zeigt sich, dass die Erwartungen der EU und der Schweiz nicht genügend deckungsgleich sind.
Das ist das zentrale Problem dieser Verträge: Ihre Tragweite ist angesichts von 1'117 Seiten und kaum überblickbaren Verweisen nicht zuverlässig abschätzbar. Der Interpretationsspielraum ist zu gross. Das Paket Schweiz-EU ist im Konfliktfall ungenügend belastbar. Das ist zum Nachteil der Schweiz.
Eines wissen wir jedoch sicher: Unser Erfolg ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis pragmatischer Selbstbestimmung. Demgegenüber integrieren die «Bilateralen III» die Schweiz künftig sektoriell in die EU. Sie gefährden damit direkt die Erfolgsposition der Schweiz.
Der Schluss ist klar: Das Paket Schweiz-EU ist zu riskant. Also: Vernünftig bleiben.
#Bilaterale3Nein
Datum: 12.1.2026 | Post: LinkedIn
Hund und Katz.
Der Bundesrat stellt uns vor die Wahl: Entweder gute Beziehungen zu unseren Nachbarn oder Selbstbestimmung. Das ist der Kern seines falschen strategischen Settings beim Paket Schweiz-EU. Er teilt damit unnötig die Schweiz.
Denn wir wollen beides.
Wir wollen gute Beziehungen zur EU und wir wollen unsere Selbstbestimmung. Wir wollen, dass unsere Bürgerrechte unangetastet bleiben. Erst wenn beides harmoniert, ist es für die Menschen gut.
Die «Bilateralen 3» erfüllen diese Forderungen nicht. Sie erzwingen ein unnötiges Entweder-Oder, sind staatspolitisch risikoreich und ihr Preis ist zu hoch.
Wir benötigen eine bürgernahe und tragfähige Lösung. Und keine, die zuerst die Erwartungen der EU erfüllt.
Bilaterale3Nein #GuteBeziehungenJa
Datum: 9.1.2026 | Post: LinkedIn
Berlin.
Nach einem gezielten Anschlag auf die Energieinfrastruktur sind in Berlin zehntausende Menschen tagelang ohne Strom. In der kältesten Jahreszeit. Es sollen rund 45'000 Haushalte sein. Also eine Stadt in der Grösse von Winterthur.
Deutschland ringt mit sich. Politisch, wirtschaftlich, infrastrukturell. Ist das die letzten Jahre noch vernünftige Politik für die Menschen? Welcher Punkt wird mit den jüngsten Ereignissen überschritten? Eines ist klar:
Wer Energie nicht verlässlich sichern kann, verliert wirtschaftlich. Deutschland stagniert seit mehreren Jahren und hat seine Dynamik verloren. Wenn der wichtigste Wirtschaftspartner und der mit 37 Prozentanteil grösste EU-Transferpartner an wirtschaftlicher und politischer Stabilität einbüsst, dann hat die Schweiz die eigenen Risiken sorgfältig abzuwägen.
Will die Schweiz ihren Wohlstand aufrechterhalten, dann drängt sich spätestens jetzt eine eigenständige, selbstbestimmte Öffnung auf. Der Schlüssel dazu ist Handlungsfreiheit. Keine falsche Sicherheit.
#Bilaterale3Nein #EnergieJa
Datum: 6.1.2026 | Post: LinkedIn
Crans-Montana.
Die Katastrophe von Crans-Montana vom 1. Januar 2026 hätte nie passieren dürfen.
Es gibt dafür keine Rechtfertigung. Das System hat versagt. Wir haben diese jungen Menschen nicht geschützt.
Gesetze und Kontrollen waren für die Opfer wirkungslos. Das ist die harte Realität für uns alle. Damit müssen wir jetzt leben.
Aber wir dürfen es nicht einfach hinnehmen. Wie lange akzeptieren wir, dass Gesetze und Vorschriften im öffentlichen Raum nicht wirkungsvoll ausgestaltet und konsequent durchgesetzt werden?
Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich bin allen Helfern, Rettungskräften, Ärzten und Pflegekräften sehr dankbar.
#Schweiz #Sicherheit #Verantwortung
Datum: 4.1.2026 | Post: LinkedIn
Ab ins 20026. Das Ziel bleibt.
Durchstarten.
Starten Sie perfekt ins 2026 durch. Wir von smartmyway danken Ihnen herzlich für Ihre Lesertreue und freuen uns auf ein Wiedersehen im Neuen Jahr. Das Ziel bleibt gleich.
#Bilaterale3Nein
Datum: 30.12.2025 | Post: LinkedIn
Glück.
Zufrieden? Nein. Aber glücklich.
Die Schweiz ist klein. Aber keine Kleinigkeit. Es muss nicht immer gross, grösser, am grössten sein. Glück hat nichts mit Grösse zu tun. Zufriedenheit möglicherweise schon.
Hier liegt die EU falsch: In ihrem Streben nach Grösse und Macht verliert sie die Nähe zu den Menschen. Sie ignoriert mit übertriebener Regulierung die Vielfalt Europas. Nicht die Schweiz sollte mehr EU wagen. Sondern umgekehrt.
Die "Bilateralen 3" integrieren die Schweiz in wichtigen Lebensbereichen in die EU. Sie bauen dort systematisch die Bürgernähe ab und entkräften die Bürgerrechte der Menschen.
#Bilaterale3Nein #GlücklichBleibenJa
Datum: 26.12.2025 | Post: LinkedIn
Wasserkraft.
Unsere Wasserkraft. Unsere Energie.
Die Schweiz könnte für Europa eine Batterie sein. Koordiniert mit den Alpenstaaten wäre das eine verfolgenswerte Initiative für die Menschen und für eine nachhaltige Energiewende. Dafür bräuchte es jedoch viel Überzeugungsarbeit und hohe Investitionen. Neue Wasserkraftwerke entstehen nicht nebenbei.
Keine Perspektive ist es, dass die Schweiz ihre Energiereserven nicht mehr primär für die eigenen Menschen und Unternehmen einsetzen kann, sondern dass EU-weit entschieden wird, wo diese Energie verbraucht wird. Damit wären die Energiewende in der Schweiz und die Versorgungssicherheit infrage gestellt.
Die „Bilateralen 3“ sind von Vorteil für die EU, aber nachteilig für die Schweiz. Beim Stromabkommen geht es nicht um ein paar Produktezertifizierungen zum Nutzen einzelner Exporteure, sondern um bezahl- und verfügbare Energie für uns alle.
Es geht um das Lebenselexier unserer Gesellschaft. Das kann nicht in die Verhandlungsmasse mit der EU gehören. Von der Bedeutung her nicht und auch sachlich nicht:
Die Wasserkraftwerke gehören Gemeinden und Kantonen und damit deren Bürgerinnen und Bürger. Darüber haben sie zu entscheiden. Weder die Kantonsregierungen noch der Bund haben hier ohne explizite Legitimation durch den jeweils zuständigen kantonalen oder kommunalen Souverän etwas zu verhandeln, weil nur so Föderalismus korrekt funktioniert.
#Bilaterale3Nein #Politik #EU #Schweiz #Energiewende #Wasserkraft
Datum: 20.12.2025 | Post: LinkedIn
Patrouille Suisse.
Symbole gehen. Die Schweiz bleibt.
Die offizielle Schweiz kann ihre Symbole ausmustern. Das lässt sich problemlos begründen. Zu teuer. Nicht mehr zeitgemäss. Egal, ob es den Menschen gefällt. Egal, ob die Patrouille Suisse mit Präzision, Sicherheit und Perfektion schweizerisches Können repräsentiert. Egal, ob Spitzensport zum Breitensport animiert und Gleiches auch für die Armee gilt.
Die offizielle Schweiz kann auch ihre Identität zur Disposition stellen. Sie kann Macht vom Souverän und vom Parlament hin zu einer supranationalen Organisation verschieben. Egal, ob es den Menschen gefällt. Egal, ob genau diese Machtordnung die Schweizerinnen und Schweizer zu den glücklichsten Menschen der Welt gemacht hat.
Die Bilateralen 3 markieren eine Zeitenwende. Sie überschreiten eine rote Linie, weil sie nicht mehr Kooperation mit der EU suchen, sondern Anschluss und Integration. Doch die Schweiz ist nicht verhandelbar. Wer will das ernsthaft anders sehen?
#Bilaterale3Nein #Politik #EU #Schweiz #Armee #Kunstflug #Luftwaffe
Datum: 18.12.2025 | Post: LinkedIn
SBB.
Unsere SBB funktioniert. Ohne Binnenmarkt.
Die SBB funktioniert, weil sie ein in sich perfekt aufeinander abgestimmtes System ist. Betrieb, Infrastruktur und Fahrplan sind fein optimiert. Menschen mit Erfahrung und Verantwortung sind dafür seit Jahrzehnten im Einsatz. Sie tun es präzise, verlässlich und bei jedem Wetter. Der Taktfahrplan ist entscheidend. Profis sorgen dafür, dass weit über eine Million Menschen täglich zuverlässig durch alle Regionen der Schweiz reisen und pünktlich ankommen.
Dieses System ist nicht vom Himmel gefallen. Die Schweizer Bevölkerung hat es über Jahrzehnte gefördert und finanziert. Es gehört ihr. Das Resultat ist nicht bloss Infrastruktur, sondern Zuverlässigkeit und damit das zentrale Fundament für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Die Bilateralen 3 beginnen in dieses System einzugreifen, obwohl es funktioniert. Selbst die heutige Anschlussfähigkeit an die Nachbarn ist nicht optimal. Die Abkommen stellen unnötig strategische Erfolgspositionen der Schweiz infrage, die sich bewährt haben und deren Stabilität wichtige Säulen unseres Wohlstands sind.
#Bilaterale3Nein
Datum: 16.12.2025 | Post: LinkedIn
Matterhorn.
Kann Brüssel Matterhorn? Eben.
Kann Brüssel Matterhorn? Eben. Und genau deshalb gilt: Zentralisierung passt nicht zur Schweiz. Denn die Menschen vor Ort verstehen am besten, wo die Probleme liegen und welche Lösungen funktionieren.
Die Schweiz ist auf diesem Prinzip aufgebaut und lebt es im Föderalismus: Gemeinden, Kantone und Bund übernehmen im Dienst der Bürgerinnen und Bürger jene Aufgaben, die sie tatsächlich übergeordnet besser lösen können. Im Gegenzug sollten sie sich strikt von allem anderen fernhalten.
Die Bilateralen 3 überlassen in relevanten Binnenmarktsektoren die Gesetzgebung der EU. Die Schweiz kann als Nichtmitglied nicht mitbestimmen. Die EU-Gesetze beeinflussen alle Ebenen der Schweizer Gesellschaft. Sie mögen für die EU passen, aber nicht mehr für die Menschen in der Schweiz.
#Bilaterale3Nein
Datum: 14.12.2025 | Post: LinkedIn
Jo Siffert.
Was bedeutet Schweiz? Nie Mittelmass.
Manche Dinge brauchen keine Erklärung.
#Bilaterale3Nein
Datum: 11.12.2025 | Post: LinkedIn
Mein Kommentar:
Für diesen Beitrag hatte ich einen Typen wie Jo Siffert oder Clay Regazzoni im Sinn. Wie sie in den 70igern mit einem Sportwagen die alte Gotthard-Passstrasse, die Tremola, heraufgefahren wären. Einfach, weil sie es konnten. Ohne Theater und Drama. Dafür mit Können und Konzentration. Was sie gesagt hätten, auf die Frage "Was bedeutet Freiheit?" - "Vollgas" wäre möglicherweise die Antwort gewesen. Oder "Alles. Ausser Mittelmass."
Die Bilateralen 3 machen aus der Schweiz Mittelmass, weil sie in relevanten Sektoren die Standortvorteile der Schweiz neutralisieren.
Swissair.
Swissair A380 im Abflug von Zürich? Ein falscher Entscheid und unsere Legenden verschwinden.
Egal, wo auf der Welt Sie in eine Swissair-Maschine eingestiegen sind, es fühlte sich immer wie Nachhausekommen an.
Swissair war mehr als eine Airline. Sie war ein Stück Schweizer Identität und Ausdruck dessen, was dieses Land stark macht: Eigenständigkeit, Innovation und Zuverlässigkeit.
Doch Identität bleibt nur bestehen, wenn wir Sorge zu ihr tragen. Sie kann verloren gehen, wenn wir Entscheidungen treffen, die unsere Selbstbestimmung schwächen.
Ein falscher Entscheid und unsere Legenden verschwinden. So wie damals aufgrund der gravierenden Fehlentscheide des Managements die stolze Swissair. Für immer. Dann bleibt heute die Swissair A380 eben nur eine Märchen, mehr nicht.
Fehlentscheide haben auch für die Schweiz Konsequenzen. Sie sind dann gravierend, wenn wir aus der Hand geben, was uns ausmacht.
#Bilaterale3Nein
Datum: 07.12.2025 | Post: LinkedIn
Medienkonferenz Vernehmlassungsergebnisse.
Die Medienkonferenz des Bundesrates zu den Vernehmlassungsergebnissen offenbart die möglichen Bruchstellen des Pakets Schweiz-EU. Dabei zeigt sich erneut: Der Bundesrat betreibt zwar Kosmetik, bleibt gegenüber den Kritikern unkooperativ und verpasst damit eine wichtige Chance für ein positives Signal.
Bruchstelle dynamische Rechtsübernahme: Die Übernahme künftiger EU-Rechtsentwicklungen bleibt ein zentraler Kritikpunkt. Der Bundesrat reagiert wenig überzeugend mit mehr Transparenz, erweiterten Mitwirkungsrechten und einem Monitoring. Das alles bringt keine Entlastung, sondern weitere Hürden.
Bruchstelle Zuwanderung (Schutzklausel): Die Schutzklausel wirkt begrenzt und verzögert, eine höhere Sozialhilfequote wird offen bestätigt. Der Bundesrat präzisiert das Gesetz und ergänzt Indikatoren, doch die Kernrisiken bleiben bestehen.
Bruchstelle Lohnschutz (Massnahme 14): Der Konflikt zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften wird nicht entschärft. Vielmehr stellt sich der Bundesrat gegen die Arbeitgeber und hält an einem Ausbau des Gewerkschaftseinflusses fest.
Bruchstelle Stromabkommen (Wasserkraft): Die Unsicherheiten rund um Wasserkraft, Konzessionen und EU-Weiterentwicklungen sind offensichtlich. Der Bundesrat liefert Interpretationen, die nicht durch offizielle Stellungnahmen der EU belegt sind.
Bruchstelle Grundversorgung Strom: Die Sorge vor Preisschwankungen für Haushalte und KMU wie auch die Streichung der Mindesteinspeisevergütungen werden nicht entkräftet. Der Bundesrat korrigiert die nationale Umsetzung (Tarife, Schwellenwerte), hat aber keinen Einfluss auf das im Abkommen festgelegte europäische Marktdesign.
Bruchstelle Vernehmlassung: Die „74 Prozent Zustimmung“ basieren auf einer umstrittenen Gewichtung. Der Bundesrat ergänzt den Begriff der Befürworter für das Paket Schweiz-EU mit Bilaterale III, was an der Sache nichts ändert: Die EU hat den bilateralen Weg als beendet erklärt.
Bruchstelle verfassungsrechtliche Fragen: Die verfassungsrechtlich heikle zusätzliche Zuwanderung stuft der Bundesrat als gering ein und lässt Art. 121a BV ausser Acht.
Bruchstelle politische Terminierung 2027: Der enge Abstimmungszeitplan bleibt bestehen. Der Bundesrat bewertet das Paket als strategisch notwendig und will das Gesamtpaket mit vier Bundesbeschlüssen gegebenenfalls an einem einzigen Abstimmungstermin entscheiden lassen (Stabilisierung, Lebensmittelsicherheit, Strom, Gesundheit).
#smartmyway #politik #integrationsvertrag #bilaterale #vernehmlassung
Datum: 05.12.2025 | Post: LinkedIn | Youtube: (Link) | Detailinformation: (Link) | Medienmitteilung: (Link)
Alfred Gantner erklärt den Zolldeal.
Alfred Gantner im Interview mit Urs Gredig.
Alfred Gantner erklärt im aufschlussreichen Interview den Zolldeal mit den USA. Er stellt sich den kritischen Fragen von Urs Gredig.
Das Ergebnis? Von 39% Zöllen anfangs August hat die Schweiz den Satz auf 15% heruntergehandelt. Gemäss Gantner entspricht dies handelsgewichtet 6.7% und damit weltweit den tiefsten Zöllen für Exporte in die USA. Zum Vergleich liegen handelsgewichtet die EU bei 10% und Grossbritannien bei 7%.
Dies zeigt den spektakulären Erfolg von Bundesrat Parmelin und dem SECO bzw. dem ganzen Team Switzerland. Sie haben ein Common Understanding abgeliefert, das so bisher nicht vorstellbar gewesen war.
Logischerweise gibt es jetzt Kritiker. Unabhängig von ihrer Motivation liegen sie falsch. Sie sollten sich mit Störmanövern aller Art zurückhalten. Das wäre anständig und für die Schweiz wichtig. Denn es geht um unser Land und nicht um Einzelinteressen.
Die Links finden Sie in den Kommentaren.
#Zolldeal #SchweizUSA #GuyParmelin #AlfredGantner #TeamSwitzerland #Handel #Politik #SECO #Europa
Bild: Screenshot SRF
Rechtsübernahme Luftverkehr.
Wird es so zukünftig mit der Rechtsübernahme bei den "Bilateralen III" laufen?
Hier die Medienmitteilung vom 26.11.2025 aus dem bestehenden Luftverkehrsabkommen.
Ein Beamter unterzeichnet im gemischten Ausschuss die Übernahme von mehreren EU-Verordnungen und eines EU-Beschlusses. Der Bundesrat nickt ab. Das war's. Kein Parlament, kein Souverän sind involviert. Die EU-Verordnungen sind damit verbindlich und direkt anwendbar in der Schweiz geworden. Ohne Schweizer Gesetzgebungsprozess. Ohne, dass sie in einem Schweizer Gesetzbuch zu finden wären, gelten die EU-Verordnungen und EU-Beschlüsse auf Schweizer Hoheitsgebiet.
So soll es also künftig mit dem Paket Schweiz-EU auch in den Sektoren Freizügigkeit, Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit funktionieren. Die Tragweite ist um ein Vielfaches grösser als diejenige beim Luftverkehr.
Lesen Sie selbst und bilden Sie sich selber eine Meinung.
Medienmitteilung:
Schweiz übernimmt neue EU-Bestimmungen für die Luftfahrt
Bern, 26.11.2025 — Der Gemischte Ausschuss des bilateralen Luftverkehrsabkommens Schweiz-EU hat am 26. November 2025 die Übernahme mehrerer EU-Erlasse durch die Schweiz beschlossen. Sie dienen dazu, in der europäischen Zivilluftfahrt ein hohes und einheitliches Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten. Der Bundesrat hatte die Übernahme der neuen Bestimmungen am 12. November 2025 genehmigt. Die neuen Bestimmungen betreffend die Bodenabfertigung, das Flugverkehrsmanagement und die Flugsicherheit. Sie treten am 1. Februar 2026 in Kraft. Für die Schweiz unterzeichnet Christian Hegner, Direktor des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL), den Beschluss des Gemischten Luftverkehrsausschusses, nachdem der Bundesrat vorgängig die Übernahme der Bestimmungen genehmigt hat.
[...]
#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #luftverkehr #rechtsübernahme
Datum: 26.11.2025 | Post: LinkedIn | Medienmitteilung BAZL: (Link)
Mein Kommentar:
Ich bin mit Ihnen einig. Zumindest bis vor ein paar Wochen. Nachdem ich mit Leuten aus der Branche gesprochen habe, habe ich festgestellt, dass viele private kleinere Flugunternehmen die letzten Jahre aufgeben mussten, weil sie die Unmengen an Gesetzen nicht mehr handhaben bzw. die dafür nötigen Kosten nicht mehr profitabel stemmen konnten.
Das Problem mit Brüssel ist, dass sie Gesetze machen, die nicht zur Schweiz passen. Beispiel Heli-Landeplätze müssen in der EU einen bestimmten Durchmesser haben, was möglichweise für grosse Transporthelis irgendwo im deutschen Flachland Sinn machen kann.
In der Schweiz fliegen sie aber in den Bergen. Dort sind die Platzverhältnisse viel enger. Diese Umstände kennen die Funktionäre in Brüssel nicht. Und wenn, dann sind sie schlicht uninteressant für sie, weil die Schweiz und ihre Interessen unter 27 Mitgliedstaaten schlicht irrelevant sind. Daher ist auch dieses Decision Shaping nicht wirksam. Die Schweizer Anliegen sind zu spezifisch, als dass sie in der EU gehört würden.
Daher ist die Unabhängigkeit der Schweiz nicht einfach eine wählbare Zusatzoption, sondern die entscheidende Voraussetzung, dass sich die Schweiz bestätigen und in der Welt durchsetzen kann. (Link)
Kommentar von Enrico Ragoni:
eine Antwort von vielen möglichen. Wir zertifizieren seit 25 Jahren nach Luftrecht. Zuerst nach BAZL, ab 2014 nach EASA. Wir bauen seit 25 Jahren mit denselben Werkstoffen, denselben Methoden, denselben Techniken, denselben Konstruktionsfaktoren die immer selben Bauteile und Ausrüstungen für die Personenrettung. Seit 2000 sind die Kosten dafür um das 15-fache gestiegen, die Zeit für ein Projekt von 6 Monaten auf 2 - 3 Jahre angewachsen, die Gebühren explodiert, der Papierberg unermesslich und die involvierten Personen der Behörde, der DO und anderer von 3 auf 15 angewachsen.
Der Gewinn an Sicherheit: Null-Komma-Null (00,00).
Wir waren immer schon sicher. (Link)
Kommentar von Enrico Ragoni:
das Thema Pilotenalter. nach den EASA Regeln darf ein Heli-Pilot ab 60 keine CAT-Flüge, also Personentransporte, mehr machen, SPO, die Montage äusserst anspruchsvoller Montagen mit mehreren Personen auf dem Mast aber schon. Nicht nur, aber auch CH-spezifisch ist, dass Heli-Piloten jeden Tag alles machen können müssen. Der Transport eines Bauarbeiters auf die Baustelle wäre CAT, ab 60 also nicht mehr erlaubt, mit dem selben Bauarbeiter aber Lasten transportieren und montieren (SPO) darf er dann schon. (Link)
Mein Kommentar:
OK, was kann für diesen Widerspruch die Begründung sein? Sicherheit? Es wäre also so, dass ein Chauffeur nicht mehr Busse fahren darf, aber Sattelschlepper allerdings schon? Das macht tatsächlich wenig Sinn. Entweder ist jemand flugtauglich oder nicht. Eine starre Altersgrenze scheint mir hier nicht sinnvoll, sondern individuelle Checks, wie mit der Senioren-Fahrtauglichkeit beim Autofahren. So stelle ich mir als Fluglaie das jedenfalls vor. Wieso macht die EU eine solche Regel? (Link)
Stimmungstest.
Der heutige Artikel von 20 Minuten nimmt anhand der Zuwanderung eine kritische Haltung zum Paket Schweiz-EU ein. Vielen Dank an Daniel Graf und Stefan Lanz für diesen Stimmungstest. Professor Reiner Eichenberger begründet die kritischen Punkte anhand von 5 Behauptungen und Professorin Astrid Epiney sieht die Zuwanderung als moderater, als oft angenommen.
Der Artikel wurde um 06:45 Uhr veröffentlicht. Zwei Stunden später gab es bereits 454 Kommentare und 2'500 Likes.
Die wahre Bombe ist jedoch die wohl nicht repräsentative Online-Umfrage: Bloss 4% von über 15'000 Abstimmenden befinden die Verträge für gut. Komplett lehnen sie 65% ab. Diejenigen, die überwiegend ablehnen, machen über 80% aus. Also vier von fünf Leserinnen und Lesern lehnen diese Verträge ab.
Der Bundesrat hantiert mit diesem Paket mit veritablem Sprengstoff. Regierungen, Politik und Lobbyisten laufen Gefahr, am Souverän vorbei zu agieren und den Zusammenhalt des Landes zu gefährden. Wenn das nur mal gut kommt für unsere Schweiz.
#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #zuwanderung
Datum: 26.11.2025 | Post: LinkedIn | 20 Minuten Artikel: (Link)
Brüssel muss entscheiden.
"Es braucht klare Entscheidungen aus Brüssel."
Mit dem Paket Schweiz-EU wird dieser Satz wohl früher oder später auch bei uns in der Schweiz zu hören sein. Hier liegt die Sorge. Die industrielle Krise in Deutschland ist nicht zufällig entstanden, sondern die Folge einer Energie- und Regulierungspolitik, die zentrale Standortfaktoren geschwächt hat. Energiepreise, Regulierungsdichte und fehlende Planbarkeit treffen nun ganze Wertschöpfungsketten, besonders in der Chemie und Pharma.
Wenn sich die Schweiz institutionell an dieses System anbindet, übernimmt sie nicht nur Marktregeln, sondern auch die strukturellen Probleme dahinter. Dann werden die heutigen Befürworter nicht mehr im Amt sein, während die Auswirkungen real werden könnten. Auch bei uns könnte der Verlust zentraler Standortvorteile drohen, besonders in Regionen wie Basel, die stark von Chemie und Pharma geprägt sind. Oder warum sollte die Schweiz in einem zunehmend schwierigeren Umfeld – jetzt neu innerhalb des Binnenmarkes – ein Sonderfall bleiben können?
#paketeuch #eu #bilaterale #smartmyway #vielseitigunabhängiggut #politik
Meine Kommentare zum obligatorischen Referendum, zur Wirkung des EU-Rechts und zu Cavallis Wochenkommentar im Blick.
Warum die Diskussion von Pfisterer zum Referendum im AAZ-Gastbeitrag zu kurz greift:
Herr Pfisterer findet, das Volksmehr genüge, und er erklärt uns, weshalb die Kantone nicht ihre Standesstimme zum Paket abgeben sollen.
Er beachtet allerdings nicht, dass es im Vorgehen des Bundesrates nicht zwingend eine Volksabstimmung gibt. Wenn keine Unterschriften gesammelt werden, bestimmt allein das Parlament über die «Bilateralen III» und damit über die sektorielle Integration der Schweiz in die EU.
Er blendet damit Kern und Tragweite der entscheidenden Diskussion aus: Nämlich, dass es in der Verantwortung einer Landesregierung liegt, dem Souverän bei einer derart weitreichenden institutionellen Veränderung zwingend das letzte Wort zu überlassen, was einem obligatorischen Referendum entsprechen würde. (Link)
Warum die Wirkung vom EU-Recht die Souveränität der Schweiz einschränken wird:
Das ist m.E. nicht korrekt. Die EU will die CH in bestimmten Sektoren in den EU-Binnenmarkt integrieren. Dort gelten übergeordnete EU-Rechtsakte (EU-Verordnungen, EU-Beschlüsse, EU-Richtlinien). Diese stellen die Gleichstellung aller Länder sicher. EU-Verordnungen gelten, ohne dass sie in das Landesrecht übernommen werden. Also gelten EU-Verordnungen auch auf CH-Hoheitsgebiet, ohne Übernahme ins CH-Gesetz. Also kein CH-Gesetzgebungsprozess, keine CH-Vernehmlassung. Die EU-Rechtsakte sind in den Sektorabkommen aufgeführt (Freizügigkeit, Luftverkehr, Lebensmittelsicherheit, Elektrizität, Gesundheit).
Ausser Landwirtschaft beinhalten alle Sektoren (auch Landverkehr und Konformität) ein institutionelles Protokoll. Sein Ziel (Art. 5): «[...], sorgen die CH und die EU dafür, dass die [...] EU-Rechtsakte nach ihrer Verabschiedung so rasch wie möglich in das Abkommen integriert werden.» Also sind auch die nicht direkt geltenden EU-Rechtsakte und Bestimmungen ins Landesrecht zu übernehmen. In diesen Fällen bleibt der CH-Gesetzgebungsprozess intakt. Lehnt die CH eine Übernahme ab, dann beurteilt der EuGH verbindlich für die CH den Sachverhalt, was Sanktionen auslösen kann.
Haben wir hier das gleiche Grundverständnis? (Link)
Warum ich zu Cavallis Wochenkommentar noch etwas ergänzt werden muss:
Der Kommentar von Rolf Cavalli fordert mehr Dialog und das ist richtig. Allerdings setzt Dialog voraus, dass zuerst klar ist, worum es inhaltlich überhaupt geht. Genau das hat der Bundesrat bis heute mit den EU-Verträgen nicht transparent gemacht, und das ist aus meiner Sicht fragwürdig, ja unzulässig.
Die Verträge zeigen unmissverständlich: Es geht nicht um Marktzugang und nicht um die Fortsetzung des Bisherigen. Es geht um unsere Freiheit, unseren Wohlstand und das Erfolgsmodell Schweiz. Es geht um das Vertrauen der Menschen in Staat und Politik sowie um die ausgleichende Rolle der Medien.
Die "Bilateralen III" riskieren all das.
Für die Menschen und die Schweiz sind die Verträge offensichtlich von Nachteil und für die EU durchwegs von Vorteil. Es sind keine guten Verträge und gehören zurück an den Absender. (Link)
Öffentliche SVP-Veranstaltung.
Hier anderthalb Stunden ernsthafte Informationen zum Paket Schweiz-EU aus einer öffentlichen Veranstaltung der SVP.
Ich gehe davon aus, dass auf LinkedIn bei einem SVP-Inhalt Abwehrreflexe entstehen.
Trotzdem teile ich das Video und empfehle es zur Ansicht, denn es geht um die Sache und um die Zukunft der Schweiz, nicht um Parteipolitik, Politikerkarrieren, Grossunternehmen, Milliardäre oder die Einzelinteressen einiger Lobbyisten.
Vielmehr machen sich vernünftige Leute echte Sorgen, und sie sind berechtigt.
In der Fragerunde wurde gefragt, warum der Bundesrat solchen Verträgen zugestimmt habe. Denn für die Menschen und die Schweiz sind die Verträge offensichtlich von Nachteil. Und für die EU durchwegs von Vorteil.
Sie werden auch nicht besser, wenn man diese Integrationsverträge „Bilaterale“ nennt, denn sie sind nicht mit den Bilaterale I und ll zu vergleichen: Die „Bilateralen lll“ integrieren die Schweiz neu in entscheidenden Gesellschaftsbereichen sektoriell in die EU. Ohne Mitbestimmung. Dafür mit dem europäischen Gerichtshof EuGH als für die Schweiz letztverbindliches Gericht. Und mit EU-Kontrolleuren, die die Schweizer Gesellschaft in diesen Sektoren kontrollieren, ob sie die EU-Vorgaben einhalten. Eine groteske Situation.
Die Frage aus dem Publikum konnte nicht beantwortet werden. Auch ich kann es mir nicht erklären. Auch nach monatelanger Auseinandersetzung mit dem Thema nicht.
Doch sehen und hören Sie selbst und bilden Sie sich Ihre Meinung.
Hashtag#smartmyway Hashtag#vielseitigunabhängiggut Hashtag#paketeuch Hashtag#bilaterale Hashtag#eu Hashtag#politik Hashtag#bundesrat SVP Schweiz
SRG Privatgebühren.
Vielleicht liege ich ja falsch: Ich habe mal die Bevölkerungsentwicklung der Schweiz und die SRG-Gebühren von Privathaushalten für die Jahre 1990 bis 2024 einander gegenübergestellt.
Die Gebühren sind im Total weit überdurchschnittlich gestiegen, obwohl die Bevölkerung und die Anzahl Haushalte deutlich weniger gewachsen sind. Ich finde das erstaunlich, denn gemäss dieser Logik wird offenbar das Programm teurer, wenn mehr Leute für die gleiche Sendung in den Fernseher gucken oder dasselbe Radioprogramm hören. Was ja nicht sein kann. Das Ganze skaliert aber irgendwie nicht.
Glücklicherweise gab es 2018 die No-Billag-Abstimmung. Danach sind die Gebühren deutlich tiefer geworden.
Der unternehmerische Blick sagt mir dazu Folgendes: Bei den Gebühren der Privathaushalte hat es heute noch deutlich Potenzial nach unten. Sofern keine strukturellen Anpassungen die Ursache für die Kostensprünge sind, sollten die Ausgaben eigentlich gegenüber 1990 sogar rückläufig sein, weil es ja in der Zwischenzeit 70% mehr Haushalte gibt.
Naja. Bevor ich gelyncht werde: 2018 hatte ich als Kulturfreund noch gegen die No-Billag-Initiative gestimmt. Kann mir das trotzdem jemand erklären?
Datum: 19.11.2025 | Post: LinkedIn
EU-Schutzzölle.
Die EU verhängt einseitig Schutzmassnahmen gegen bestimmte Ferrolegierungen, die für die Stahlherstellung wichtig sind. Hier werden Handelshemmnisse hochgezogen, wie die EU es für richtig hält. Diese betreffen auch Norwegen und Island, die EWR-Mitglieder und somit Teil des Binnenmarktes sind. Also auch willkürlich gegen assoziierte Partner der EU.
Wer noch länger von stabilen Beziehungen mit der EU aufgrund des Pakets Schweiz-EU bzw. den "Bilateralen" träumt, sollte seine Position spätestens jetzt verantwortungsvoll überdenken.
#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu
Deal!
Die NZZ meldet Einigung im Zollstreit und 15 Prozent für die Schweiz. Wir sagen: Gut gemacht und grosses Dankeschön an alle Beteiligten. Das ist eine gute Nachricht für die Schweiz. Sie hat jetzt praktisch dieselben Konditionen wie die EU. Die Schweiz kriegt den Deal, ohne ihre Souveränität zu tangieren. Nicht so, wie das mit dem Paket Schweiz-EU der Fall wäre. Das ist jetzt auch klar geworden. Schönes Wochenende!
#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #deal #usa #15
Die Zeitenwende kündigt sich an.
Wir zeigen faktenbasiert, warum die Schweiz im Jahr 2035 mit rund 10 Millionen Einwohnern ihren Wendepunkt erreicht. Danach kann sie nur noch reaktiv stabilisiert werden. Dieses Szenario wäre durch eine gezielte und nicht zuletzt humane Steuerung der Zuwanderung vermeidbar.
Auf welcher Grundlage die SVP ihre 10-Millionen-Initiative entwickelt hat, wissen wir nicht. Doch wir müssen zugeben: Unser Artikel ist beunruhigend. Er zeigt auf, dass der Handlungsbedarf im Bereich des Bevölkerungswachstums dringender wird. Ähnlich dem Frosch im langsam kochenden Wasser, bleibt die Schweiz diesbezüglich regungslos.
Vielmehr tut sie das Gegenteil und will die Zuwanderung mit dem Paket Schweiz-EU noch befeuern. Es bleibt die Frage, wer die Schweiz da noch verstehen soll.
Lesen Sie unseren Artikel: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-zuwanderung
P.S. Bitte beachten: Hier schreibt das Team von smartmyway. Wenn wir Kommentare nicht beantworten, heissen wir sie nicht stillschweigend gut.
#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #zuwanderung
Nussbaumer liegt falsch.
Nein, da liegt Herr Nussbaumer falsch, und er wird das wissen. Schauen wir nüchtern hin:
Ginge es nach dem Bundesrat, würde auch das Volk nicht befragt. Denn er erachtet es offenbar als unnötig, sonst würde er ein obligatorisches Referendum fordern.
Das ist die Grundhaltung der Schweizer Regierung: Ein Parlamentsbeschluss genügt. Und tatsächlich, wenn niemand die nötigen 50’000 Unterschriften für das Referendum sammelt, gibt es für das Volk gar nichts abzustimmen.
Obwohl man bei diesem Paket genau das tun müsste. Denn die Schweiz tritt sektoriell dem EU-Binnenmarkt bei und integriert sich in den Sektoren Freizügigkeit, Luftverkehr (ergänzt), Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit ins EU-Rechtssystem, inklusive EU-Rechtsprechung.
Das Paket ist damit ein Bündel von Integrationsverträgen, folglich von Assoziierungsabkommen. Nach gesundem Menschenverstand gilt damit, was in Artikel 140 BV zum obligatorischen Referendum steht:
Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet: […] b. der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften […]
Und nein: Die Kantone haben nicht gesprochen. Die Kantonsregierungen haben sich geäussert. Ihre Mehrheit vertritt eine antidemokratische Position:
Indem sie das Ständemehr ablehnt, verweigert sie ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich als Stand äussern können. Das ist unerhört.
Regierungen und Politik haben vergessen, wem sie zu dienen hätten: den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern. Mit solchen Entscheidungen tun sie das nicht. Wer glaubt ernsthaft, dass das gut ist?
#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #schweizeu
Datum: 9.11.2025 | Post: LinkedIn | Post Eric Nussbaumer: (Link)
Post Eric Nussbaumer:
#SchweizEU
Die Mehrheit der Kantonsregierungen (21 an der Zahl) sind für das Vertragspaket Schweiz-EU. Nach eingehender Prüfung sind die Kantonsregierungen der Ansicht, dass die vom Bundesrat erzielten Ergebnisse und die innerstaatlichen Umsetzungsmassnahmen ihren Erwartungen entsprechen.
Die Mehrheit der Kantonsregierungen ist auch für ein fakultatives Referendum (15 an der Zahl).
Nüchtern gefragt, soll man die Kantonsmehrheit überstimmen? Es ist doch der Kern unseres Staatswesens - die Kantone. Sie haben gesprochen.
Erntezeit.
Eine weitere Öffnung der Zuwanderung durch das Paket verstärkt diese Tendenz und dürfte zu einem spürbaren Rückgang des Wohlstandsniveaus führen. Dieses Paket gefährdet damit die Zukunftsperspektive der Menschen und markiert eine empfindliche wirtschaftliche und institutionelle Zäsur.
Die Schweiz verdankt ihren Erfolg ihren eigenen Rahmenbedingungen: der direkten Demokratie, dem Föderalismus und der Neutralität, die letztlich die besten Voraussetzungen für die Entfaltung jedes Menschen schaffen. Die vorgesehene weitere Vertiefung der Integration würde diese Erfolgsposition systematisch schwächen.
Die Schweiz sollte stattdessen umgehend eine Wachstumsstrategie einleiten, die konsequent Qualität vor Quantität stellt. Der erste Schritt dazu ist, das fehlgeleitete Paket Schweiz-EU zu stoppen.
Wir fragen: Wann ist für die Menschen wieder Erntezeit?
Falls Sie es anders sehen, lesen Sie für die Faktenlage gerne unseren Artikel unter: https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-erntezeit
#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #reallöhne #wohlstand
Datum: 4.11.2025 | Post: LinkedIn | Unser Artikel (Link)
Passend dazu ein Post von Jon Pult:
Die heutige Schuldenbremse ist schlicht unvernünftig, weil sie die rekordtiefen Bundesschulden in Richtung Netto-Null treibt. Im Gegensatz zur Reduktion der Treibhausgasemissionen ist das jedoch kein kluges Ziel. Denn null Schulden sind letztlich teurer und ökonomisch ineffizienter als eine moderate Schuldenquote.
Aktuell liegt diese – also die Bundesschuld im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung – bei nur rund 18 Prozent. Es gibt eigentlich keine guten Gründe, diese Quote weiter zu senken. Wir brauchen eine Schuldenbremse, die die Neuverschuldung bremst, nicht den Schuldenstand dauerhaft senkt. Ein vernünftiges Ziel wäre etwa, die Schuldenquote über die Konjunkturzyklen hinweg zu stabilisieren – also dafür zu sorgen, dass sie bei rund 18 Prozent bleibt.
Dies würde garantieren, dass
a) die Schweiz finanzpolitisch weiterhin Musterschülerin bliebe,
b) kein Investitionsstau entstünde und
c) die Aufrüstung der Armee nicht zulasten anderer Staatsaufgaben ginge.
Weil der Bundesrat die heutige Schuldenbremse jedoch zum Dogma erklärt hat, werden völlig unnötige Abbauprogramme wie das „Entlastungspaket 27“ aufgegleist. Sie machen die Bevölkerung wütend, weil dabei zahlreiche legitime Interessen – Bildung, Kultur, Sport, Mobilität, Medien, Klima, Natur, Gleichstellung, Regionalpolitik, Tourismus, Landwirtschaft, internationale Zusammenarbeit, Kinderbetreuung usw. – missachtet oder gegeneinander ausgespielt werden.
Der daraus entstehende Streit und der wüste Verteilungskampf wären völlig unnötig, würde der Bundesrat bei der Schuldenbremse volkswirtschaftliche Vernunft höher gewichten als fiskalpolitischen Fetischismus.
Schweiz, wann findest du auch in der Finanzpolitik zu deinem vielgepriesenen Pragmatismus?
Wer mir in ökonomischen Fragen nicht vertraut, soll diesen Beitrag von Fabio Canetg hören:
Datum: 3.11.2025 | Post: LinkedIn | Beitrag (Link)
Meine Antwort:
Wenn ich Ihren Post lese, finde ich, dass die Schuldenbremse nicht genügt. Wir benötigen dringend eine Ausgabenbremse und eine Halbierung der Steuerlast. Das ist die Diskussion, die wir führen sollten. (Link)
Antwort Pult:
Mir scheint, Sie haben eine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Die Ausgabenquote des Bundes ist seit 1990 ziemlich stabil. Wie kommen Sie da auf die Idee, wir hätten ein Ausgabenproblem? (Link, inkl. Grafik der Ausgabenquote)
Meine Antwort:
Es ist ökonomischer Unsinn, die Ausgabenquote zum BIP stabil zu halten, wenn das BIP absolut massiv wächst. Das bedeutet nicht Stabilität, sondern einen Staat, der im Gleichschritt mit dem Wirtschaftswachstum immer teurer wird, ohne produktiver zu werden.
Die Schweiz bläht sich auf, während das qualitative Wachstum ausbleibt. Die Bevölkerung wächst deutlich weniger, die Reallöhne stagnieren seit Jahren. Wenn die Staatsquote konstant bleibt, steigen die Kosten pro Kopf im Umkehrschluss überproportional.
Kein Unternehmen kann so wirtschaften, es würde am Skaleneffekt der Grösse bankrott gehen. Das Motto ist nicht "work hard" sondern "work smart".
Wir stellen also fest, dass das Wachstum nicht bei den Menschen ankommt, während die Ausgabenlast steigt. Die Bevölkerung spürt die Konsequenzen und ihr Unmut wächst überproportional. Das müsste Sie als Sozialdemokrat eigentlich interessieren, nicht wahr? (Link)
Ständemehr KdK.
Die Mehrheit der Kantone hat sich gegen das Ständemehr entschieden. Wir begründen dazu unser Ja aus Bürgersicht in drei Punkten.
1. Art. 140 BV «Obligatorisches Referendum»
«1 Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet: a. die Änderungen der Bundesverfassung; b. der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften; [...]»
Das Paket Schweiz-EU stellt eine sektorielle Integration der Schweiz ins EU-Rechtssystem dar, weil EU-Verordnungen zum ersten Mal in politisch relevantem Mass direkt in der Schweiz gelten, ohne dass sie in einem Schweizer Gesetz zu finden wären.
Die Abkommen zu Freizügigkeit, Luftverkehr (ergänzt), Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit sind somit Integrationsverträge und damit völkerrechtlich verbindliche Assoziierungsabkommen. Sie binden die Schweiz an die supranationale EU. Damit greift Art. 140 BV Abs. 1 lit. b, und das Ständemehr ist erforderlich.
2. Art. 190 BV «Massgebendes Recht»
«Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend.»
Das Paket Schweiz-EU verschiebt Gesetzgebungskompetenz in die EU und ordnet damit EU-Recht vor Schweizer Recht ein. Heute sind in Art. 190 BV Schweizer Recht und Völkerrecht gleichgestellt, was demnach in der Verfassung zu korrigieren ist. Für eine Änderung der Bundesverfassung ist gemäss Art. 140 BV Abs. 1 lit. a ein Ständemehr erforderlich.
3. Das Ständemehr ist die Stabilitätsgarantie der Schweiz
Wer ein Ständemehr für das Paket Schweiz-EU als unnötig erachtet, verkennt seine Tragweite. Nicht nur aus rechtlicher, sondern auch aus staatspolitischer Sicht gilt: Die Kantone sind keine einfachen, untergeordneten Verwaltungseinheiten des Bundes.
Kantone und Bund teilen sich die staatliche Hoheit. Die kantonale Souveränität ist in Art. 3 BV verankert. Die höchste Souveränität liegt beim Volk. Eine Veränderung der Souveränität tangiert alle, womit auch aus Vernunftgründen ein Ständemehr angebracht ist.
Das Wichtigste zum Schluss: Die Vielfalt der Schweiz ist in ihren 26 Kantonen abgebildet. Das Ständemehr hält die Schweiz zusammen. Es ist die Stabilitätsgarantie der Schweiz. Damit müssen alle sorgfältig umgehen und in jedem Fall eine Zerreissprobe verhindern.
Das hat heute die Mehrheit der Kantone nicht getan. Erleben wir den Anfang vom Ende des Föderalismus?
P.S. Bitte beachten: Hier schreibt das Team von smartmyway. Wenn wir Kommentare nicht beantworten, heissen wir sie nicht stillschweigend gut.
#smartmyway #vielseitigunabhaengiggut #politik #paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #kantone #ständemehr
Datum: 24.10.2025 | Post: LinkedIn | NZZ: Artikel
Mein Kommentar 1:
Ja, das Volk entscheidet. Doch hier haben nicht die Kantone entschieden, sondern die Kantonsregierungen. Die Kantone hätten entschieden, wenn die Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Kantons entschieden hätten. Das wäre eben dieses Ständemehr.
Die Mehrheit der Kantonsregierungen entzieht damit ihren Bürgerinnen und Bürgern das Recht, in dieser entscheidenden Frage zur Souveränität als Stand mitbestimmen zu dürfen. Wenn die Regierung darüber zu entscheiden beginnt, worüber die Bürgerinnen und Bürger abstimmen dürfen, können wir auch in die EU eintreten und die Schweiz zu einer repräsentativen Demokratie umbauen. Das mag jetzt pointiert klingen, aber im Kern trifft es die Sache. Dieser Umstand ist meines Erachtens im höchsten Masse fragwürdig.
Die Konferenz der Kantonsregierungen ist eine interkantonale öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, geschaffen durch eine Vereinbarung der Kantone (Konkordat), und beispielsweise im Kanton Aargau vom Regierungsrat beschlossen.
Es spricht ja nichts dagegen, wenn sich die Kantone abstimmen und voneinander lernen. Aber eine politische Parallelorganisation ist auf dieser Ebene meines Erachtens in der Bundesverfassung nicht vorgesehen.
Mein Kommentar 2:
Da sind wir uns einig. Unabhängig von den Verträgen, die man gut oder schlecht finden darf, geht mir Folgendes durch den Kopf:
Kantonsregierungen, die nicht wollen, dass sich ihr Stand zu dieser Frage mit dieser Tragweite dediziert äussern kann, sind für mich fragwürdig. Entfremden sich solche Repräsentanten nicht von ihren Leuten?
Zürich, Waadt, Bern, Aargau und Genf könnten im Alleingang ein Volksmehr schaffen. Sie vertreten jedoch nur 10 Standesstimmen. D.h. sie könnten den Rest der Schweiz und somit 36 Standesstimmen überstimmen. Was würde in einem solchen Fall mit der Schweiz passieren?
Ich will es nicht weiter auf die Spitze treiben, aber die Politik und die Regierungen sind mit diesem Paket grenzwertig unterwegs. Ich frage mich, warum.
Mein Kommentar 3:
Danke für die Rückmeldung. Wer die Abkommen liest, dem wird klar, dass die Rechtslage sehr unklar ist. Ihr Punkt 1 mit dem Satz: «Die Schweiz ... überträgt keine Hoheitsrechte an EU-Institutionen und behält ihre volle Souveränität.» gibt die Abkommen schlicht falsch wieder. Zum Artikel 190 argumentiert der Post stichhaltig, und ich verzichte auf eine Wiederholung.
Die Mehrheit der Kantonsregierungen entzieht mit ihrem gestrigen Entscheid ihren Bürgerinnen und Bürgern das Recht, in dieser entscheidenden Frage zur Souveränität als Stand mitbestimmen zu dürfen. Dafür ist das Ständemehr da.
Das ist keine juristische Frage mehr, sondern eine politische Haltung, die ich in diesem Kontext sehr fragwürdig finde. Die Bundesverfassung wurde nicht für Juristen geschrieben, sondern hat ausschliesslich dem Souverän zu dienen. Das geht aktuell vergessen.
Mein Kommentar 4:
Bis jetzt habe ich zu diesem Abkommen nur Tausende Seiten gesehen und dazu eine Menge von Behauptungen und Kontroversen. Fakten? Risk Assessments? Szenarien? Entscheidungsgrundlagen? Fehlanzeige. Also ist es unsere Bürgerpflicht, unsere Einschätzung der Lage dem Bundesrat mitzuteilen. Lesen Sie gerne hier.
https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-klartext
Meine anderen Kommentare:
(Link)
Erlauben Sie mir ein offenes Wort? Sie sprechen von «uns» und «wir» und meinen sich. Es ist Ihre Sicht, Herr Luchsinger, oder jene der Befürworter inklusive Lob von Herrn Michel.
Sie zählen die grossen Probleme auf und meinen ihre Komplexität. Da entsteht die Sehnsucht nach Sicherheit, die Ihnen niemand geben wird. Das muss die Schweiz als Erstes verstehen.
Doch die Situation ist mit gesundem Menschenverstand lösbar. Dabei zählt nur das Ergebnis, nennen Sie es Wirkung. Sagen Sie mir bitte konkret, was sich ändern soll und wozu. Wie soll das Haus Schweiz künftig aussehen: Welche Farbe soll es haben, welche Zimmer, und für wie viele Menschen? Soll die Schweiz Eigentümerin oder Mieterin sein?
Wenn Sie von «Kooperation statt Isolation» sprechen, widerspricht niemand. Doch das Paket will «Integration statt Kooperation». Macht die EU also bessere Gesetze als die Schweiz? Darum geht es in dieser Diskussion.
Dafür soll die Schweiz ohne Not einen Teil ihrer Souveränität aufgeben? Herr Ragoni kennt das Ergebnis dieses Konzepts im Luftverkehr aus eigener Erfahrung. Warum ihm nicht vertrauen? Es ist klug zu wissen, welches Ergebnis bereits vorliegt und ob es funktioniert. Unklug wäre es, die gleichen Fehler zu multiplizieren.
(Link)
Tatsächlich bricht derzeit schon etwas mein Bild von der Schweiz und ihren Institutionen zusammen. Diese KdK steht meines Erachtens schon als eigene Körperschaft sehr schräg in der Landschaft. Offensichtlich geht gerade die Bodenhaftung verloren, wie ich es noch nie und sonst so nur im Ausland zu beobachten glaubte.
Wenn ich hier auf LinkedIn erklären muss, was es mit diesen Ständen auf sich hat, komme ich mir wie im falschen Film vor. Dieses Unverständnis ist unglaublich.
Die Leute in Regierungen und Ständerat gehören mehrheitlich zu meiner Generation. Diese kann offensichtlich fehlendes Staatsverständnis nicht mit schlechten Schulen erklären. Denn die waren ausgezeichnet. Also was ist ihre Agenda?
Meine Hoffnung sind die Jungen. Erklären wir ihnen, was Sache ist und dann wird es drehen.
(Link)
Nein, ich weiss es nicht, da haben Sie recht, und ich behaupte das auch nicht. So wie es die Kantonsregierungen auch nicht wissen.
Denn dafür müssten die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen können. Das liegt im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und in ihrer Verantwortung als Souverän.
Damit wären wir wieder beim Ständemehr, genau dafür ist es bei einer Frage dieser Tragweite da.
(Link)
Danke für die Rückmeldung. Wer die Abkommen liest, dem wird klar, dass die Rechtslage sehr unklar ist. Ihr Punkt 1 mit dem Satz: «Die Schweiz ... überträgt keine Hoheitsrechte an EU-Institutionen und behält ihre volle Souveränität.» gibt die Abkommen schlicht falsch wieder. Zum Artikel 190 argumentiert der Post stichhaltig, und ich verzichte auf eine Wiederholung.
Die Mehrheit der Kantonsregierungen entzieht mit ihrem gestrigen Entscheid ihren Bürgerinnen und Bürgern das Recht, in dieser entscheidenden Frage zur Souveränität als Stand mitbestimmen zu dürfen. Dafür ist das Ständemehr da.
Das ist keine juristische Frage mehr, sondern eine politische Haltung, die ich in diesem Kontext sehr fragwürdig finde. Die Bundesverfassung wurde nicht für Juristen geschrieben, sondern hat ausschliesslich dem Souverän zu dienen. Das geht aktuell vergessen.
(Link)
Ich hoffe, dass ich für Sie nicht herumlamentiere. Ich fände es auch nicht gut, einfach tiefer in diese EU-Mühle einzusteigen. Solcher Fatalismus wäre mir fremd.
Meiner Ansicht nach ist es mit den neuen Abkommen das erste Mal politisch tatsächlich relevant. Schengen-Dublin und das bisherige Luftverkehrsabkommen konnten noch als "technische Abkommen" durchrutschen, wenn man beide Augen zudrückte.
Aber im Grunde sehe ich das wahrscheinlich gleich wie Sie: Unserer Begründung nach wird bereits dort die Verfassung verletzt. Aber das ist ja offenbar kein Problem für die Politik, wie die Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative zeigt. Und wer dort aufmerksam liest, stellt auch fest, dass diese Verträge auch den Artikel 121 BV Abs. 4 verletzen.
Sehr gerne nehme ich Ihr Angebot an und werde mich mit Ihnen in Verbindung setzen.
(Link)
Nein, ich weiss es nicht, da haben Sie recht, und ich behaupte das auch nicht. So wie es die Kantonsregierungen auch nicht wissen.
Denn dafür müssten die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen können. Das liegt im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und in ihrer Verantwortung als Souverän.
Damit wären wir wieder beim Ständemehr, genau dafür ist es bei einer Frage dieser Tragweite da.
(Link)
Sehe ich gleich. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso die EU die Schweiz in ihrem politischen Rechtsraum haben will. Keine der möglichen Antworten erachte ich als positiv für die Schweiz. Je länger je mehr macht dieses Paket für mich keinen Sinn. Es ist ein Gewurschtel, das niemand wirklich überblickt. Und seine Konsequenzen sind nicht absehbar.
Entweder ist die Schweiz Teil der EU oder des EWR oder sie erneuert ein umfassendes Freihandelsabkommen für Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der jeweilig gültigen Regeln. Das wären vernünftigere Optionen, als dieses neue Rahmenabkommen.
JUSO-Erbschaftssteuer.
Wir stellen klar: Wir werden die JUSO-Erbschaftssteuerinitiative aus denselben Gründen ablehnen wie das Paket Schweiz-EU. Beide setzen zu stark auf Umverteilung statt auf Leistung und Eigenverantwortung.
Denn es geht um Umverteilung und Gleichschaltung. Der Unterschied ist, dass das eine national wirkt, das andere in allen EU-Mitgliedsländern. Die JUSO-Erbschaftssteuerinitiative geht also weiter: Sie verschlechtert gezielt im internationalen Vergleich die Position der Schweiz.
Doch was ist mit der EU? Aus unserer Sicht ist die EU in zweierlei Hinsicht ein Umverteilungsprojekt:
Erstens über die Transferunion, wo Steuergelder aus besser gestellten Mitgliedsländern in andere Mitgliedsländer fliessen. Solche Transferzahlungen sind ein wesentlicher Grund, warum die EU heute nicht auseinanderfällt. Der Ausgleich wird von der Kommission als Druckmittel eingesetzt, falls ein Mitgliedsland nicht spurt. Dieser Umstand ist auch der entscheidende Unterschied zum Schweizer Finanzausgleich.
Deutschland ist 2024 mit 13.1 Milliarden der grösste Nettozahler. Österreich bezahlt als Vollmitglied auf diesem Weg jährlich 850 Millionen. Die Schweiz müsste für die Bilateralen jährlich bereits 350 Millionen bezahlen.
Zweitens über Regeln. Diese sind entscheidend. Die EU harmonisiert die Regeln für alle und egalisiert damit systematisch Standortvorteile. Für ein kleines Land wie die Schweiz sind diese jedoch für seinen Wohlstand entscheidend. Diese Vereinheitlichung baut in der Schweiz Wohlstand ab und «transferiert» ihn in die EU.
Die EU strebt beispielsweise Steuerharmonisierung an, indem sie Mindeststandards und einheitliche Bemessungsgrundlagen einführt und den Spielraum für nationalen Steuerwettbewerb systematisch einschränkt (z. B. bei der Unternehmensbesteuerung, MwSt und CO₂-Abgaben). Erbschaftssteuern standen bereits auf der Agenda der EU. Es ist unseres Erachtens nur eine Frage der Zeit, bis die EU das Thema wieder aufgreift.
Mit der sektoriellen Integration der Schweiz durch die «Bilateralen III» (Paket Schweiz-EU) würde die Schweiz in den Sektoren Freizügigkeit, Luftverkehr (ergänzt), Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit erstmals in politisch relevantem Mass Teil des EU-Rechtssystems. Die entsprechenden EU-Verordnungen wären auch in der Schweiz gültig, ohne dass sie Teil eines Schweizer Gesetzes wären. Dies ohne Mitbestimmung der Schweiz.
Wir fragen uns: Was ist der nächste Schritt nach dem Paket Schweiz-EU? Welche Sektoren werden die Bilateralen IV beinhalten? Wann würde der EU-Beitritt die logische Fortführung und die Schweiz damit Vollmitglied der Transferunion? Und: Sind sich alle Bürgerlichen bewusst, was sie hier dem Souverän empfehlen?
P.S. Bitte beachten: Wenn wir Kommentare nicht beantworten, heissen wir sie nicht stillschweigend gut.
#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #vielseitigunabhaengiggut #smartmyway #fdp #juso #erbschaftssteuer
Datum: 23.10.2025 | Post: LinkedIn
Mein Kommentar 1:
Hier zum Vergleich der Schweizer Finanzausgleich (provisorisch für 2026): Das Gesamtvolumen beträgt 6.4 Milliarden CHF (2/3 durch Bund finanziert, 1/3 Kantone).
Vergleicht man den Schweizer Finanzausgleich von 6.5 Milliarden CHF mit dem EU-Zahlungstopf von 24.3 Milliarden EURO, dann wird deutlich, wie massiv die Schweiz untereinander solidarisch ist. Es zeigt die Tiefe und Stärke des Schweizerischen Föderalismus.
Es ist unverständlich, wie aus dieser Sicht für das Paket Schweiz-EU mit seiner grossen Tragweite, auch für die Souveränität der Kantone, das dafür nötige Ständemehr ernsthaft angezweifelt bzw. ignoriert wird.
Zur Erinnerung: Art. 140 Obligatorisches Referendum
1 Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet:
a. die Änderungen der Bundesverfassung;
b. der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften;
c. die dringlich erklärten Bundesgesetze, die keine Verfassungsgrundlage haben und deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt;
diese Bundesgesetze müssen innerhalb eines Jahres nach Annahme durch die Bundesversammlung zur Abstimmung unterbreitet werden.
Quelle: https://www.data.finance.admin.ch/superset/dashboard/finanzausgleich/
Mein Kommentar 2:
Hier aktuelle Informationen zu den Nettozahlern und Nettoempfängern in der EU. 2024 haben die Nettozahler rund 24.3 Milliarden Euro einbezahlt (die auf andere Länder umverteilt wurden).
Deutschland bewältigt alleine davon 13.1 Milliarden Euro und Frankreich knapp 4.8 Milliarden EURO. Das heisst, dass diese beiden Länder 74% bezahlen und damit im wesentlichen die EU schultern. Wenn diese beiden Länder Probleme bekommen, dann gilt das ähnlich für die ganze EU.
Quelle: https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger-in-der-eu/
Liebe SBB.
Heute also die SVP. Nach der FDP-Show im Wankdorf geht es die bodenständige Partei generalstabsmässig an, und sie liefert ab. Im Taktfahrplan quasi. Zehn Arbeitsgruppen haben sich je ein Thema aus dem Paket Schweiz-EU gegriffen, und jedes wird von SVP-Parlamentarierinnen und Parlamentariern an der Pressekonferenz vom 20.10.2025 kurz und bündig vorgestellt.
Ihr Urteil ist klar: Ein Unterwerfungsvertrag sei es, und nach den knapp 55 Minuten hat man dem Ganzen nichts mehr beizufügen. Denn was die SVP zu diesem Vertrag zu sagen hat, ist haarsträubend, und man fragt sich mehrfach: Wer, um Gottes willen, hat so ein unausgewogenes Machwerk bloss verhandelt?
Eine geballte Ladung also. Konsternation garantiert. Doch dieses Paket braucht sowieso starke Nerven. Wie auch immer Sie zu diesen Verträgen stehen, bilden Sie sich selbst Ihr Urteil (Link)
Speziell empfehle ich den Leuten bei der SBB das Kurzreferat von Benjamin Giezendanner: Es ist eindrücklich, wie sich dieser Transpörtler für die SBB ins Zeug legt. Es zeugt von ehrlichem Verantwortungsbewusstsein für unser Land. Trotzdem: Hat die SBB auch eine Meinung zu diesem Paket? Wäre es nicht an der Zeit, dass sie sich dazu äussert? Denn es geht um sehr viel. Nicht nur um Trassen und Taktfahrpläne. Hier geht’s zum Referat (Link).
P.S. Verzeihen Sie, wenn ich nicht alles beantworte. Es heisst also nicht, dass ich unbeantwortete Kommentare stillschweigend gutheisse. Vielen Dank fürs Mitwirken.
#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #perspektiveschweiz #vielseitigunabhaengiggut #smartmyway #sbb #svp
Datum: 20.10.2025 | Post: LinkedIn | Medienmitteilung dazu: SVP
Goodbye FDP.
Deine enttäuschten Wählerinnen und Wähler verabschieden sich von dir, liebe FDP. Dein Entscheid zum Paket Schweiz-EU ist falsch, weil er die Erfolgsgeschichte der Schweiz gefährdet und den Jungen die volle Entscheidungsfreiheit raubt.
Für Freiheit. Für Vernunft. Für Bürgernähe. Perspektive Schweiz.
Tes électrices et électeurs déçus te disent adieu, chère PLR. Ta décision concernant le paquet Suisse-UE est erronée, car elle met en péril la réussite de la Suisse et prive les jeunes de leur pleine liberté de choix.
Pour la liberté. Pour la raison. Pour la proximité citoyenne. Perspective Suisse.
Le tue elettrici e i tuoi elettori delusi ti dicono addio, cara PLR. La tua decisione sul pacchetto Svizzera-UE è sbagliata, perché mette in pericolo il successo della Svizzera e priva i giovani della piena libertà di scelta.
Per la libertà. Per la ragione. Per la vicinanza ai cittadini. Prospettiva Svizzera.
Tias votantas e tes votants disillusi fan adia cun tai, cara PLD. Tia decisiun davart il pachet Svizra-UE è fallada, perquai ch’ella metta en privel il success da la Svizra e priva ils giuvens da la plena libertad d’elecziun.
Per la libertad. Per la raschun. Per la vicinanza cun ils burgais. Perspectiva Svizra.
Your disappointed voters are saying goodbye to you, dear FDP. Your decision on the Switzerland-EU package is wrong because it jeopardises Switzerland’s success story and deprives young people of full freedom of choice.
For freedom. For reason. For closeness to the people. Perspective Switzerland.
#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #perspektiveschweiz #vielseitigunabhaengiggut #smartmyway #fdp
Datum: 18.10.2025 | Post: LinkedIn | Medienmitteilung dazu: FDP
Die Bewährungsklausel.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Eine «Bewährungsklausel» ist der nächste Akt im nationalen Polittheater um die EU-Verträge.
Unseres Erachtens überblickt der Vorschlag die Tragweite dieser Abkommen nicht: Es braucht Jahre, bis sich die Folgen dieser Verträge vollständig zeigen. Dann sind sie allerdings unumkehrbar.
Dann haben diese Integrationsverträge bereits derart irreparablen Schaden angerichtet, dass die Schweiz aussteigen möchte. Es müsste also bereits sehr viel passiert sein. Eine mittlere Staatskrise beispielsweise? Was muss erst passieren, dass die Schweiz eine Klausel gegenüber der EU auslöst?
Wir können dieser Logik nicht folgen, weil für solche drastische Fälle die bereits in den Abkommen enthaltenen Kündigungsmöglichkeiten reichen würden.
Frau Binder findet die Bewährungsklausel sehr gut. Kompromisse scheinen wichtiger als das Verständnis der Substanz der Abkommen. Gleicher Meinung ist auch Eric Nussbaumer. Der alte Fuchs scheint hier Vorteile für seine Position auszumachen.
Nun gut. Eines ist bei dieser fragwürdigen Politik klar: Ihre Politiker wären bereits im Ruhestand, wenn die Klausel ausgelöst würde und die kommende Generation sagen müsste: «Alles ist kaputt! Wir wollen raus! Egal, was es kostet!»
Das Paket Schweiz-EU ist eine Zerreissprobe. Zwischen Alt und Jung. Mit oder ohne Bewährungsklausel.
Für Freiheit. Für Vernunft. Für Bürgernähe. Perspektive Schweiz.
#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #vernehmlassung #politik #vielseitigunabhaengiggut #perspektiveschweiz
Die Bilateralen ein Erfolg?
Der Bundesrat schickte am 13. Juni 2025 das Paket Schweiz-EU in die Vernehmlassung. In den nächsten Tagen werden Positionen und Parolen gefasst.
Zweifellos waren die Bilateralen I und II für die Wirtschaft ein grosser Erfolg: Das nationale BIP stieg seit 1990 um 129 Prozent, von Index 100 auf 229 Prozent. Doch Fehlanzeige für die Menschen: Ihr Realeinkommen wuchs im selben Zeitraum gerade einmal um 15 Prozent auf 115 Prozent. Gleichzeitig nahm die Bevölkerung um rund einen Drittel zu. Die beiliegende Grafik im ersten Kommentar gibt einen Überblick (Quelle: BfS).
Der wirtschaftliche Erfolg ist wichtig, doch die Menschen profitieren nicht fair genug davon. Die Vorteile konzentrieren sich bei Wenigen und der Staat wächst ungebremst mit. Diese Entwicklung gefährdet den sozialen Frieden.
Denn die Nachteile bleiben bei den Leuten hängen: Sie haben unter dem zunehmenden Konkurrenzdruck in allen Lebensbereichen zu kämpfen. Akute Wohnungsnot, überlastete Infrastruktur, Staus, Probleme an Schulen, Krankenkassenprämien, belastete Sozialwerke, unterbesetzte Sicherheitskräfte, Überregulierung, fehlender Sparwille. Wollen Sie die Liste fortführen?
Gerade jene trifft es also, die dieses grosse BIP mit täglicher Arbeit, Motivation und Leistung überhaupt erst schaffen. Aus der Gesamtsicht ist dies sehr bedenklich.
Und jetzt? Das Paket Schweiz-EU packt noch die sektorielle Integration der Schweiz in den EU-Rechtsraum obendrauf: Bei Freizügigkeit, Luftverkehr, Lebensmittelsicherheit, Strom und Gesundheit wird künftig EU-Recht direkt auf Schweizer Boden gelten. Das schwächt die Bürgerrechte und verändert das demokratische Grundverständnis. Dazu kommen jährliche Milliardenzahlungen an eine supranationale Organisation, die die Schweiz endlich integrieren und damit den EU-Binnenmarkt auch politisch vollenden will.
Es ist an der Zeit, dass grosse Unternehmen und Wirtschaftsverbände wieder verstärkt ihre Verantwortung für das Land und seine Menschen wahrnehmen. Wer derart profitiert hat, soll jetzt wieder nachhaltig zum sozialen Frieden beitragen und dieses Paket an den Absender zurückweisen.
Das Paket Schweiz-EU ist eine Zerreissprobe. Lehnen Sie es ab.
#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #direktedemokratie #vielseitigunabhaengiggut
Fahne im Wind.
Für die Schweiz bedeutet unseres Erachtens das Paket Schweiz-EU einen Wendepunkt. Statt der bisherigen Kooperation rückt die sektorielle Integration der Schweiz in den EU-Rechtsraum ins Zentrum. Lesen Sie dazu unsere Stellungnahme an den Bundesrat.
Wir erwarten von den Parteien im linken Spektrum keine Überraschung. Das Paket nivelliert den Wohlstand der Schweiz auf EU-Niveau, was letztlich im Sinne eines sozialistischen Gesellschaftsmodells wäre. Sie werden also trotz Lohndruck zustimmen.
Auf der anderen Seite verfolgt die SVP eine klare Ablehnung, insbesondere mit Blick auf die geplante Erweiterung der Personenfreizügigkeit. Sie befürchtet gleichzeitig einen erheblichen Verlust an Souveränität. Sie lehnt das Paket folglich ab.
Doch welche Rolle spielen die Mitte und die FDP? Diese Parteien werden über das Paket entscheiden und haben sich bisher nicht eindeutig positioniert. Die FDP-Delegierten sollen am 18.10.2025 zu einem Schluss kommen. Erste Signale deuten auf ein Sowohl-als-auch hin. Also nach wie vor keine Klarheit.
Klar ist jedoch: In beiden Parteien werden viele Mitglieder heimatlos. Und zwar unabhängig davon, welche Parole gefasst wird. Der logische Schluss wäre eine neue Partei, denn ein solcher Widerspruch wird auf Dauer zu einem unlösbaren innerparteilichen Konflikt führen. Es braucht also eine Partei der vernünftigen Mitte, die das Paket unmissverständlich ablehnt. Die Meinungsdifferenz wäre sonst schlicht zu gegensätzlich.
Wie sehen Sie die Rolle von FDP und Mitte in dieser Frage? Was sind Ihre Schlüsse?
#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #direktedemokratie #vielseitigunabhaengiggut
Datum: 7.10.2025 | Post: LinkedIn | Artikel: Vernehmlassungsantwort
Cassis im Interview.
Was vom Interview mit Bundesrat Cassis in der NZZ bei uns hängen bleibt, ist nicht Klärung, sondern dass das Paket Schweiz-EU in unserer Analyse einen anderen Eindruck hinterlässt.
Er geht davon aus, dass die FDP den bilateralen Weg weiterhin unterstütze, und meint damit sein Paket Schweiz-EU. Die Bilateralen seien erfolgreich gewesen, und so werde auch das Paket wirken. Doch wenn der bilaterale Weg funktioniert hat, braucht es keine Änderung. Dann braucht es kein Paket, das partnerschaftliche Kooperation durch sektorielle institutionelle Integration ersetzt oder Äquivalenz durch automatische Rechtsübernahme.
Hüftprothesen unterliegen neu den Regeln des EU-Binnenmarkts, weil die Schweiz im Gesundheitssektor Teil davon wird. Egal ob für Portugal oder die Schweiz: EU-Vorgaben gelten grundsätzlich im ganzen Binnenmarkt gleich.
Die Zuwanderung sei ein Wohlstandsfaktor, doch der Nachweis fehlt. Mehr Wohnungen sollen den Druck lindern, lösen aber die Ursache nicht. Und: Der Zustrom aus dem riesigen Zuwanderungspotenzial der EU kann endlos sein, besonders wenn sich die Perspektiven in der EU weiter verschlechtern.
Wenn die 10-Millionen-Initiative eine Hypothek für das Paket sei, wird klar: Die Schweiz kann ihre Zuwanderung nicht mehr steuern, ohne Sanktionen zu riskieren.
Der Familiennachzug wird nicht nur auf Ehepartner ausgeweitet, sondern auch auf eingetragene Partnerschaften und Drittstaatsangehörige. Erweitert die EU ihre Regeln, kann die Schweiz zwar ablehnen, muss aber mit Sanktionen rechnen. Zudem entfällt die Anforderung einer angemessenen Wohnung, und Arbeitslosigkeit gilt als Erwerbstätigkeit.
Die Schutzklausel ist eine Notbremse, die die Schweiz faktisch nur mit EU-Zustimmung betätigen kann. Tut sie dies ohne, drohen Sanktionen. Im Übrigen habe die Schweiz diese Klausel rückblickend kaum angewendet. Warum auch: Selbst Entscheide wie jener zur Masseneinwanderungsinitiative wurden nicht umgesetzt.
Die Verfassung wird so zum politischen Spielraum. Was gelte, bestimme das Parlament je nach Lage. Das EDA entscheide, ob eine Änderung eines EU-Rechtsakts direkt übernommen oder dem Parlament vorgelegt wird. Demokratische Entscheide werden zweitrangig.
Mögliche EU-Sanktionen sollen gleich im Abstimmungsbüchlein erscheinen. Das beeinflusst die freie Willensbildung und widerspricht Art. 34 BV.
Das Schiedsgericht hat zwar das letzte Wort, muss bei EU-Recht aber die Auslegung des EuGH übernehmen.
Das Paket sei sein europapolitisches Vermächtnis. Doch ob er die Abstimmung noch mitbegleitet, lässt Cassis offen.
Wir fragen uns, ob wir dieselben Abkommen gelesen haben.
#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #direktedemokratie #vielseitigunabhaengiggut
Endlich.
Endlich hat ein ausgewiesener Experte das Paket Schweiz-EU und die Informationspolitik des Bundesrates seziert. Prof. Carl Baudenbacher zeigt haarscharf auf, weshalb beides nicht nur fragwürdig, sondern im Kern demokratiegefährdend ist. Er demontiert das institutionelle Fehlkonstrukt des Pakets Schweiz-EU nach allen Regeln der Kunst. Sein Urteil fällt in jeder Hinsicht verheerend aus.
Wir verzichten bewusst auf eine Kommentierung. Denn Sie sollten sich seine zehn Seiten selbst zu Gemüte führen. Es braucht keine weiteren Erklärungen unsererseits. Die Schieflage des bundesrätlichen Schiffes ist erschreckend und erstmals in ihrer ganzen Tragweite sichtbar.
Prof. Carl Baudenbacher schafft damit heilsame Tatsachen. Er terminiert auf einen Schlag das unreflektierte Zitieren aus Dokumenten, die nur die halbe Wahrheit verbreiten, oft nicht verstanden sind und zu einfältigen Parolen führen. Denn wer das weiterhin tut, outet sich selbst als inkompetent und unreflektiert.
Wir empfehlen die Lektüre sehr. Besonders jenen, die das Paket befürworten oder ihm nahestehen. Denn ab sofort können sie sich nicht mehr blind auf die Unterlagen des Bundesrates berufen. Sie übernehmen jetzt selbst Verantwortung. Prof. Baudenbacher hat ihnen unmissverständlich das nötige Wissen zur fehlgeleiteten institutionellen Anbindung der Schweiz geliefert.
Niemand kann mehr behaupten, er oder sie hätte es nicht gewusst.
Den Parlamentarierinnen und Parlamentariern von FDP und Mitte empfehlen wir, jetzt sehr genau hinzuschauen, wie sie sich zum Paket positionieren. Denn sie werden am Schluss ausschlaggebend sein.
Hier finden Sie das vollständige Dokument von Prof. Carl Baudenbacher beim Nebelspalter AG.
#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #eugh #schiedsgericht #politik #vielseitigunabhaengiggut
Datum: 26.9.2025 | Post: LinkedIn | Dokument beim Nebelspalter downloadbar
Die Verzwergung der Schweiz.
Es laufe das «Endspiel» der UBS in der Schweiz, findet CH Media in der Sonntagszeitung. Tatsächlich ein treffender Begriff für einen möglichen Wegzug der Grossbank nach New York. Unseres Erachtens wäre das sehr nachteilig für die ganze Schweiz, nicht nur für den Bankenplatz. Die Folgen dieser Strukturänderung sind nicht wirklich abschätzbar.
Wir fragen uns, wieso sich der Bundesrat je länger je mehr von Regulierungen leiten lässt und sich daraus vermeintliche Sicherheit verspricht. Hat er vergessen, dass Unternehmertum die Schweiz gross gemacht hat? Es sind die Steuern von erfolgreichen Firmen und fleissigen Bürgern, die Land und Staat finanzieren. Niemand anders sonst.
Es gehört also kluges Abwägen von Chancen und Risiken dazu, bevor neue Gesetze erlassen werden. Denn diese Regulierungen verändern die Rahmenbedingungen für erfolgreiche Firmen substantiell auf einen Schlag oder schleichend über die Zeit. Die oft nur vordergründige Verbesserung entpuppt sich für das Unternehmen als inakzeptabler Wettbewerbsnachteil. Sein Wegzug bedeutet Verlust von erheblichem Steuersubstrat für die Schweiz. Und noch schlimmer ist der Verlust von Arbeitsplätzen. Das Ergebnis ist eine klassische Lose-Lose-Situation.
Seit wann überwiegt im Bundesrat die Ansicht, dass mit Regulierung der Wohlstand unseres Landes besser garantiert werden könne als mit starken Unternehmen? Woher kommt diese falsche Ansicht? Wieso sollen andere besser für Sicherheit und Stabilität sorgen können als die Schweiz? Oder warum werden Standortrisiken anderen überlassen und die damit eingehandelten existentiellen Nachteile ausgeblendet?
Und zu welchem Preis? Wenn Angst vor der eigenen Stärke die Motivation ist, dann kann es teuer werden. Unsichere suchen Unterschlupf bei Stärkeren. Die Schweiz hat dazu keine Veranlassung. Denn diese Haltung untergräbt den Bestand der Schweiz und destabilisiert das Fundament der Schweiz. Wir nennen diesen Vorgang die Verzwergung der Schweiz. Er ist unnötig und auf lange Sicht sehr nachteilig für unser Land. Diese Agenda steuert die Schweiz in die falsche Richtung.
Dasselbe bei der bundesrätlichen Unterstützung für das Paket Schweiz-EU, ein Bündel von sektoriellen Integrationsverträgen, durch die EU-Recht direkt in der Schweiz gelten soll. Bundesrat und Parlament geben damit ihre Verantwortung an die EU ab. Im Gegenzug verschlechtern sich systematisch die Standortvorteile der Schweiz. Der Bundesrat sucht Stabilität in der EU, was angesichts ihrer Instabilität und Probleme für jeden erkennbar im Kern ein Widerspruch ist.
Nur eine schwache Schweiz braucht keine UBS und die Integration in die EU. Eine starke Schweiz benötigt die UBS und dafür kein Paket Schweiz-EU. Eine starke Schweiz benötigt einen starken Bundesrat und dieser die richtigen Ratgeber.
#ubs #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #vielseitigunabhängiggut
Datum: 20.9.2025 | Post: LinkedIn | Aufänger von Patrik Müller, CH Media : LinkedIn
Wir haben verstanden. Ihr auch?
Ja, wir haben es ja verstanden:
Die Nordwestschweiz, angeführt von den Wirtschafts- und Staatseliten aus Pharma und Medtech, will um jeden Preis das Paket Schweiz-EU. Keine Studie ist zu kühn, kein Argument zu schmal, kein EDA-Satz zu keck.
Die letzten Kritiker sind bis zum 18. Oktober gleich noch ausgetauscht.
Und toll, dieser Rückenwind vom Bundesrat, dazu die Kellnerschar aus Handelskammern, Konferenzen und Verbänden, die fleissig sekundiert. Auch wenn keiner so recht weiss, was eigentlich genau serviert wird.
Oh, Freude herrscht. Das Gemälde heisst Bilaterale III, das ist wohl gedacht. Es reicht doch schon fast zum letzten Abendmahl, alles wohlfein von Siegfried und Ypsilon im Nussbaumhain angerichtet.
Denn ohne das Paket bricht die Welt zusammen. Mindestens.
Und die Störenfriede aus der SVP sind bald kunstvoll gecancelt, auch dieses Problem dann elegant gelöst.
Wirklich? Genügt das für die ganze Schweiz?
Wir haben es ja verstanden: Sparen wir uns doch gleich die Abstimmung! Setzen wir die Verträge einfach per Notrecht durch. Schliesslich ging das beim grossen Corona-Maskenball auch.
Wozu also noch die Absolution des Volkes? Ein halbes Mehr genüge, das lästige Ständemehr ist ja ohnehin schon weggewischt. Alles reine Zeitverschwendung.
Oh, macht doch, was ihr wollt.
Macht macht doch, was sie will.
Wirklich?
Heil dir, Helvetia. Die Zukunft gehört den Menschen, nicht Siegfried, nicht Ypsilon, nicht Nussbaumhain.
Ja, das haben wir verstanden.
Ihr auch?
#paketeuch#integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #schweiz #vielseitigunabhängiggut
Datum: 19.9.2025 | Post: LinkedIn
Etwa wegen besserem Marktzugang?
Wir schauen in die Sterne und verstehen nach Wochen intensiver Auseinandersetzung mit dem Paket Schweiz-EU die Argumentation der Befürworter immer noch nicht. Vielleicht übersehen wir etwas, aber entscheiden Sie selbst.
Hier das erste Pro-Argument:
Die Befürworter des Pakets Schweiz-EU sagen, dass der Marktzugang verbessert wird.
Wir sehen das anders, denn …
1. … das Freihandelsabkommen von 1972 schafft die wesentlichen Vorteile für den gegenseitigen Handel mit der EU.
2. … das Paket Schweiz-EU verbessert primär die automatische Anerkennung für Medtech, was das Engagement einzelner Grossindustrieller und Lobbyisten erklärt. Die Verbesserung könnte auch separat und deutlich schlanker erreicht werden. In der gleichen Weise sind punktuell die Pharma und damit die Kantone beider Basel am Gesundheitsabkommen interessiert. Auch Energieberater, die indirekt von der Förderung erneuerbarer Energien abhängen, profitieren.
3. … die Interessen grosser Firmen, weniger Branchen oder einzelner Kantone sind nicht deckungsgleich mit den Interessen der Menschen in der Schweiz. So sind hohe Strompreise beispielsweise für die Anbieter gut, aber schlecht für die Verbraucher. Und entscheidend ist, dass Interessen einzelner Interessengruppen nicht zum Nachteil von allen erkauft werden dürfen.
Vielmehr verliert die Schweiz faktisch die Kontrolle …
1. … über ihre Zulassungsregeln für Arzneimittel und Medizinprodukte.
2. … über ihre Markt- und Förderregeln im Stromsektor und eigenständigen Einsatz ihrer strategischen Versorgungsinfrastruktur zugunsten der Schweiz.
3. … über ihre Lebensmittelstandards.
Wollen wir das? Wir finden, dass diese Bilanz für ein derart folgenreiches Paket nicht genügt und sagen Nein.
#paketeuch #integrationsvertrag #bilaterale #eu #politik #vielseitigunabhängiggut
Datum: 16.9.2025 | Post: LinkedIn
Spannende Kommentare (den ganzen Dialog und weitere Kommentare finden Sie in LinkedIn):
#1 Herr Nussbaumer
Kommentar:
Danke für die Gegenüberstellung. Aber gerade beim Marktzugang greift die Kritik zu kurz.
Das Freihandelsabkommen von 1972 regelt Zölle – nicht den Binnenmarktzugang. Für moderne Branchen wie Medtech, SaaS oder CleanTech reicht das nicht. Und es betrifft auch ganz praktische Dinge: Heute muss ein Schweizer Hersteller von Brandschutztüren doppelt zertifizieren – einmal für die Schweiz, einmal für die EU. Mit den Bilateralen III würde eine Zertifizierung in der Schweiz direkt für die EU anerkannt.
Es stimmt, dass Branchen wie Medtech & Pharma profitieren. Aber sie sind auch zentrale Pfeiler unserer Exportwirtschaft. Ihr Erfolg schafft Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und Innovation – von denen die ganze Schweiz profitiert.
Die Übernahme von EU-Regeln ist kein „Blankoscheck“, sondern beschränkt auf jene Bereiche, die direkt mit dem Binnenmarktzugang zu tun haben. Dort gelten dieselben Spielregeln für alle Teilnehmer – auch für Liechtenstein oder Norwegen. Soll die Schweiz hier andere Regeln beanspruchen als alle anderen?
Am Ende geht es nicht darum, ob einzelne Interessengruppen gewinnen, sondern ob die Schweiz im grössten Markt der Welt konkurrenzfähig bleibt. Genau dafür schaffen die Bilateralen III stabile Rahmenbedingungen.
Meine Antwort:
Merci für die differenzierte Rückmeldung, die ich schätze. Aber wieso braucht es dazu gleich dieses überdimensionierte Paket? Die Schweiz ist auch ohne äusserst erfolgreich, auch ausserhalb des EWR und ohne seine institutionelle Einbettung der erwähnten Länder. Und selbst für Brandschutztüren könnten längst pragmatische Lösungen gefunden werden, wenn es denn wirklich so nötig wäre.
Unseres Erachtens bedient das Paket Einzelinteressen, schiesst über das Ziel hinaus und schränkt die Schweiz unnötig ein. Oder anders gesagt: Die Befürworter wollen eine sektorielle Integration in die EU und wir verstehen nicht, warum dies für die Schweiz besser sein soll, als gezielte Abkommen zwischen befreundeten Staaten. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Anpassungsfähigkeit an neue Situationen für ein starkes kleines Landes erfolgsentscheidend ist.
Kommentar:
Danke für die differenzierten Rückmeldungen. Ich möchte nur drei Punkte herausgreifen:
Die Bilateralen III führen nicht automatisch zu mehr Sozialhilfebezug. Das wünschen sich die EU Staaten für sich selber ja auch nicht. Auch künftig gilt: Leistungen gibt es nur mit klaren Bedingungen wie Erwerbstätigkeit und aktiver Arbeitssuche. Ein Restrisiko wird bleiben, da dies vom Vollzug abhängt.
Die Wohnungsnot wiederum hat viel mit zu wenig Neubauten und langen Bewilligungsverfahren zu tun. Diese Probleme lösen wir mit Schweizer Bau- und Raumplanungspolitik, nicht über den Stopp von Handelsabkommen.
Zum Paket: Klar, einzelne Probleme könnte man auch mit Mini-Abkommen lösen. Die Erfahrung zeigt, dass die EU punktuelle Lösungen nicht mehr verhandelt. Ein Gesamtpaket ist die Bedingung, damit unser Zugang zum Binnenmarkt gesichert bleibt. Genau darum haben auch Länder wie Norwegen oder Liechtenstein die gleichen Spielregeln akzeptiert – und profitieren seither massiv.
Am Ende ist es eine Abwägung zwischen Vor- und Nachteilen. Ich sehe mehr Chancen, gerade für stabile Rahmenbedingungen und den Marktzugang, verstehe aber natürlich die Bedenken, insbesondere beim Thema Sozialhilfe und Wohnungsmarkt.
Meine Antwort:
Ich kann Ihrer Darstellung folgen. Ich stolpere über einen zentralen Punkt, den Sie anziehen: Die EU will keine punktuellen Lösungen mehr. Hier sind wir bei des Pudels Kern. Die EU will mit Nachdruck eine Integration der Schweiz in ihren Binnenmarkt. Genau dies wollte die Schweiz bis jetzt nicht, auch nicht sektoriell. Das war der Grund für das EWR-Nein und für den Ausstieg aus dem InstA.
Im besten Fall bietet die EU nur noch eine sektorielle EWR-Variante ohne Mitbestimmungsrecht. Im Gegenzug lässt sie sich diese „Inkonsequenz“ mit Kohäsionszahlungen der Schweiz abgelten. Die Schweiz unterzieht sich also der EU. Es ist eine klare Abkehr von der bisherigen Linie der Kooperation und überschreitet mit der Geltung von EU-Verordnungen und Richtlinien entscheidend die bisherige rote Linie der Schweiz.
Was wäre der nächste Schritt? Die Ausdehnung dieses Settings auf alle Abkommen mit der EU? Wäre es nicht ehrlicher, wenn dem Souverän nochmals die Frage gestellt würde, ob die Schweiz in den EWR eintreten sollte, weil die EU nichts anderes mehr akzeptiert? Oder sollten wir den Status quo belassen und die Zeit arbeiten lassen? Wäre das nicht die Diskussion, die der Bundesrat zuerst hätte führen sollen?
Kommentar:
Die EWR-Abstimmung liegt 33 Jahre zurück, die Welt hat sich massiv verändert. Und ja, selbst mit den Bilateralen III haben wir eine gewisse „Extrawurst“, weil wir Regeln nur in klar definierten Bereichen übernehmen. Der EWR geht hier viel weiter und bindet Länder wie Norwegen oder Liechtenstein fast vollständig an das Binnenmarktrecht.
Aber genau das ist der Punkt: Die Bilateralen III sind kein EWR light, sondern ein gezieltes Paket. Wir sichern uns Marktzugang in Bereichen wie Forschung, Medtech und Energie, behalten aber mehr Eigenständigkeit, zahlen weniger und bekommen trotzdem Planungssicherheit für unsere Unternehmen.
Vielleicht ist in Zukunft ein EWR-Beitritt tatsächlich zielführender, als sich ständig durchzuwursteln. Aber das entscheidet letztlich der Souverän und ja ein mutiger Bundesrat könnte dies anstossen 😉
Meine Antwort:
Danke Herr Nussbaumer. Was für jeden von uns letztlich Freiheit im Kern bedeutet, verändert sich auch in 33 Jahren nicht, stimmt’s? Wenn ich Sie korrekt interpretiere, laufen wir auf der strategischen Ebene nicht völlig asynchron? Sie sagen, ein mutiger Bundesrat. Ich würde ergänzen: Mut zur Ehrlichkeit gegenüber dem Souverän.
Sie bringen mit Planungssicherheit ein neues Pro-Argument ins Spiel, nämlich jenes der Stabilität. Darauf werde ich in meinem nächsten Beitrag eingehen. Ich werde dazu unsere Wahrnehmung darlegen und freue mich jetzt schon auf Ihre Reaktion.
#2 Herr Gehler
Kommentar:
Wenn die Grundannahmen falsch sind, sind meist auch die Folgerungen falsch. Das völlig veraltete FHA von 1972 ist ein Zollabkommen. Wir reden hier über die Teilnahme an einem der grössten Binnenmärkte der Welt mit 450 Mio. Konsumenten/32 Ländern. Zum Vgl.: Der Binnenmarkt der Schweiz umfasst 9.5 Mio. Konsumenten. Die gleichberechtigte Teilnahme am gemeinsamen europäischen Binnenmarkt ist im Übrigen in vielen Fällen der Grund, weshalb Schweizer Produkte auch international gefragt sind. In einem Binnenmarkt von 9.5 Mio. hätten viele gute (Zwischen-)Produkte gar nicht die Möglichkeit, zu konkurrenzfähigen Preisen auf den Markt zu kommen.
Völlig falsch ist die Aussage, dass die gleichberechtigte Teilnahme am gemeinsamen Markt den grossen Konzernen diene und in ihrem Interesse sei. Das Gegenteil ist wahr. Während grosse Konzerne in andere Länder ausweichen können, wo sie bereits Niederlassungen haben, ist das exportierende KMU auf Gedeih und Verderben auf gleich lange Spiesse wie die Konkurrenz in anderen europäischen Staaten angewiesen. Werden die Chancen dieser KMU geschmälert, wandern sie aus, wie konkrete Beispiele aus dem MedTech-Sektor zeigen oder sie schliessen ihre Pforten. Ein klassisches Eigentor einer isolierten Schweiz.
Meine Antwort:
Schön wieder von Ihnen zu hören, Herr Gehler. Möglicherweise sind Ihre Sichtweisen einseitig und nicht für die ganze Schweiz gleich relevant? Gerne stelle ich wieder richtig.
Nach den Trump-Zöllen wissen wir heute alle genau, was Freihandel bedeutet und wie wertvoll ein Freihandelsabkommen für die Schweiz ist.
Mit der Verlagerung sprechen Sie ein heikles Thema an: Beispielsweise plant Ypsomed gemäss Cash vom 6.8.2025 die Verlagerung nach Deutschland und in die USA aufgrund dieser neuen Situation. Dies unabhängig davon, ob die Schweiz nun das Paket mit der EU abgeschlossen hat oder nicht.
KMU haben eine sehr kritische Meinung zu den EU-Regulationen, weil diese für sie einen grossen Aufwand bedeuten und das Geschäft eher behindern als fördern.
Der Freihandel basiert für die EU auf dem Freihandelsabkommen von 1972, das selbstverständlich laufend aktualisiert wurde. Es ermöglicht den zollfreien Zugang zum EU-Binnenmarkt.
2024 gingen rund 51 Prozent der Schweizer Exporte in die EU (bzw. rund 70 Prozent der Importe), fast ausschliesslich Industrieprodukte, die dank diesem Abkommen zollfrei gehandelt werden (siehe Schweizer Aussenhandel EFD).
Also ein seit Jahrzehnten erfolgreiches Instrument.
Luftverkehr, ein Erfahrungsbericht.
Endlich mal einer, der weiss, wovon er spricht und nicht nur Parolen von Parteien, Lobbyverbänden oder die Faktenblätter des Bundes nachplappert und die Abkommen wahrscheinlich nur vom Hörensagen kennt.
Hier teilt ein Unternehmer und Pilot seine Erfahrung mit dem Luftverkehrsabkommen. Dort gilt EU-Recht seit 2006 direkt in der Schweiz. Es zeigt sich: Der damit verbundene Regulierungsaufwand vernichtet offenbar ganze Geschäftszweige.
Mit dem Paket Schweiz EU soll dieser Unsinn auf Freizügigkeit, Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit ausgedehnt werden. Dem sagt man seitens der Befürworter bessere Stabilität, mehr Verlässlichkeit, besseren Marktzugang und höhere Wettbewerbsfähigkeit. Das Aus von Unternehmen ist dann der dafür zu akzeptierende Kollateralschaden, quasi als Preis für einen unnötigen Integrationsvertrag mit der EU.
Wieso sollen wir unserer Wirtschaft einen solchen Schaden zufügen? Finden Sie das im Ernst gut? Lesen Sie den Bericht von Kantonsrat Philipp Köppel.
#paketeuch #integrationsvertrag #eu #luftverkehr
Datum: 15.9.2025 | Post: LinkedIn | Erfahrungsbericht Philipp Köppel
Merbec 2025.
Heute haben wir den 2025er Merbec gelesen. 261.2 kg Trauben, ein erfreuliches Ergebnis in einem schwierigen Jahr. Unser 2022er hat nach 2.5 Jahren im Eichenfass den Weg in die eleganten 3.75-dl-Fläschchen gefunden und ist una bomba geworden: Merlot 90 Prozent, Malbec 10 Prozent. Dieses Jahr ist das Verhältnis zugunsten des Malbec verschoben. Wir sind auf das Ergebnis gespannt.
Während der Lese habe ich mir VoGunte auf YouTube angehört. Ein Berner, früher Bademeister, heute Dokfilmer in den USA. Mir gefällt seine ausgewogene Art zu berichten. Ein Stil, den ich mir auch vermehrt von NZZ, Tages-Anzeiger, Blick und SRF - Schweizer Radio und Fernsehen wünschen würde. Das täte auch der Diskussion rund ums Paket Schweiz-EU gut.
Empfehlung (Berndeutsch mit Untertiteln)
#wein #medien #integrationsvertrag #paketeuch
Datum: 15.9.2025 | Post: LinkedIn
Ja zur Vernunft.
Ja zur Vernunft. Nein zum Paket Schweiz-EU. Das Paket Schweiz-EU ist kein Schritt nach vorne, sondern ein Schritt in die falsche Richtung.
Marktzugang, Stabilität und Kooperationen sind auch ohne direkt in der Schweiz geltendes EU-Recht möglich. Die Schweiz hat es in den letzten Jahrzehnten bewiesen: mit Freihandel, Eigenständigkeit und guter Nachbarschaft. Dort sehen wir den nötigen Handlungsbedarf: Was tut die Schweiz für ihre besten Handelspartner? Ihre besten Freunde?
Mehr EU bringt derzeit nicht mehr. Ausser mehr Unvernunft.
Den ganzen Artikel finden Sie hier (Link)
#integrationsvertrag #paketeuch #EU #politik #vielseitigunabhängiggut
Datum: 13.9.2025 | Post: LinkedIn
«siamo liberi, siamo svizzeri!»
Unseren Beitrag versteht, wer die Episode 173 vom Podcast Feusi Federal gehört hat. Dort unterhalten sich Bundesrat Ignazio Cassis und Dominik Feusi zum Paket Schweiz-EU, zu Konfitüre und im Kern zu «siamo liberi, siamo Svizzeri». Ein sympathisches und informatives Interview mit einigen kontroversen Aussagen, die wir hier kommentieren:
1. «Wir können immer Nein sagen.»
Mit der Paketübernahme übernimmt die Schweiz aus den Abkommen auf einen Schlag 4’388 Seiten EU-Recht. Dort gilt entweder alles oder nichts. Die Schweiz kann nicht zu jeder EU-Rechtsakte einzeln Nein sagen. Das ist eine grosse Veränderung.
2. «Es bleibt beim Status quo.»
Das direkte Anwenden von EU-Recht in der Schweiz (Integrationsmethode) und die institutionellen Protokolle mit Streitbeilegung und Ausgleichsmassnahmen sind neu.
3. «Für Firmen ohne EU-Export ändert sich nichts.»
In Sektoren mit Integrationsmethode, also Freizügigkeit, Luftverkehr, Lebensmittelsicherheit, Strom und Gesundheit gelten EU-Rechtsakte auch in der Schweiz. Die Schweiz ist in diesen Sektoren Teil des EU-Binnenmarktes. Schweizer Unternehmen sind z.B. deutschen Unternehmen gleichgestellt und müssen die Binnenmarktregeln einhalten, unabhängig davon, ob sie exportieren oder nicht. Schweizer Gerichte müssen EU-Recht anwenden. Grundlage ist Art. 190 BV: Mit der Annahme des Pakets wird das enthaltene EU-Recht Teil des Völkerrechts und damit verbindlich.
4. «Ausgleichsmassnahmen beschränken sich auf die betroffene Produktelinie.» (z.B. Lebensmittel)
Die Erfahrung z.B. mit Horizon, Börsenäquivalenz oder Medtech zeigt eine andere Situation: Die Schweiz kann zu späteren einzelnen Veränderungen Nein sagen, verbunden mit dem Risiko, dass die EU sektorübergreifende Ausgleichsmassnahmen ergreift.
5. «Souveränität ist seit 25 Jahren eingeschränkt.»
Ist das jetzt positiv oder negativ? Ein schlechter Zustand müsste nicht stabilisiert werden. Ein guter Zustand jedoch schon. Doch warum soll dafür noch mehr Souveränität aufgegeben werden?
6. «Demografie erzwingt mehr Zuwanderung.»
Es gibt Alternativen mit qualitativem Wachstum, das für die Schweiz nachhaltiger wäre.
7. «Das Volk hat beim Paket das letzte Wort. Nach 20 Jahren soll diese Diskussion abgeschlossen werden.»
Das wünschen wir uns auch.
#integrationsvertrag #paketeuch #EU #politik #vielseitigunabhängiggut
Datum: 5.9.2025 | Post: LinkedIn | Podcast: Feusi Federal Episode 173
Dicke Post.
Die 6 Rappen werden fallen.
Wir haben vor einem Monat auf dieses Thema hingewiesen (LinkedIn), jetzt hat es den Weg in die breite Öffentlichkeit gefunden. Es freut uns aus folgenden Gründen:
Es ist ein perfektes Beispiel für verpasste Bürgernähe am Beispiel, wie mit kleinen Stromproduzenten umgesprungen wird.
Die im Stromabkommen integrierten EU-Rechtsakte zeigen deutlich auf, wie sie künftig das Schweizer Recht beeinflussen werden.
Sonntagszeitung und Tagesschau vom 31.8.2025 haben ganze Arbeit geleistet. Es geht um die Minimalvergütung von kleinen PV-Anlagen für die Stromeinspeisung, von der rund 250'000 Haushalte betroffen sind. Empörung überall.
Eines ist klar: Die Streichung der Minimalvergütung ergibt sich zwingend aus der Marktlogik der Verordnung (EU) 2019/943 und dem EU-Beihilferecht. Darüber müssen wir nicht streiten.
Doch die NZZ deckt am 2.9.2025 auf: Gemäss BFE würde es genügen, die Vergütung lediglich während Phasen mit negativen Preisen auszusetzen, um sie mit dem EU-Recht in Einklang zu bringen. Das BFE meint: Im Hinblick auf die Stabilität und den kostspieligen Ausbau des Stromnetzes sei es wichtig, die Preissignale des Markts auch an Besitzer kleiner Solaranlagen weiterzugeben.
Also an jene, die keinerlei Einfluss auf den Markt haben. Sondern im Vertrauen auf den Bundesrat massiv investiert und ihren Teil zur Energiewende geleistet haben.
Das ist dicke Post. Der Bundesrat korrigiert seinen eigenen Entscheid von diesem Frühling im Artikel 12 der EnV über den Kopf der betroffenen Bürger hinweg? Das BFE lässt keine Bürgernähe erkennen, indem es die Rahmenbedingungen für 250’000 private Stromproduzenten zu deren Nachteil und in eigenem Ermessen ändert, wenn dies möglicherweise auch weniger scharf gehen könnte.
Aus eigener Erfahrung haben wir im Kanton Tessin mit der AET erlebt, was es heisst, einem Stromversorger ausgeliefert zu sein, der in eigenem Interesse operiert. Die Interessen der Kleinen, also der Bürgerinnen und Bürger, sind nicht die Interessen der Stromversorger. Wir haben es im Artikel «Wenn die Grossen mit den Kleinen» festgehalten.
So hat der SP-Mann Benoît Gaillard verstanden, worum es geht: Das Stromabkommen ist nachteilig für die Kleinen, also die privaten Stromverbraucher und Stromproduzenten. Diesen Eindruck haben wir auch und sehen es mit dem Stromabkommen in unserem Artikel «Das Stromabkommen. Passt die Lösung zum Problem?» gleich für die Schweiz.
#paketeuch #EU #politik #schweizsicht #vielseitigunabhängiggut
Datum: 2.9.2025 | Post: LinkedIn | Artikel: NZZ
Hintergrundinformationen.
Unter Bezug auf einen Artikel in der Sonntagszeitung berichtet die Tagesschau vom 31.8.2025 ausgewogen:
Wer in der Schweiz Strom ins Netz einspeist, erhält eine Mindestvergütung vom lokalen Stromversorger. Mit dem Stromabkommen falle diese Mindestpreisgarantie weg. 250’000 Haushalte wären betroffen.
Benoît Gaillard (SP, Link) zeigt auf, dass sich mit dem Wegfallen der 6-Rappen Minimalvergütung für viele Leute eine PV-Anlage nicht mehr lohnt.
Benoît Revaz (Direktor Bundesamt für Energie, SP, Link) schreibt: “Die Mindestvergütung gilt nur, wenn kein anderer Preis zwischen Betreiber und Abnehmer vereinbart ist, was heute selten der Fall ist. Viele Netzbetreiber zahlen zusätzlich zur Abnahmevergütung auch noch einen Preis für die Herkunftsnachweise.”
Eric Nussbaumer sagt, dass Albert Rösti das EU-Recht zu konservativ auslege und die Förderung der Erneuerbaren beschneiden wolle.
Gaillard zieht den Schluss: “Wer bei dieser totalen Liberalisierung gewinnen würde, ist ganz klar, es sind die gewinnorientierten Stromfirmen.”
Berichterstattung löst empörte Reaktionen bei den Befürwortern aus.
Reaktionen der Befürworter des Stromabkommens:
Thomas C. Nordmann wirft der Sonntagszeitung faktenwidrige Berichterstattung vor und fordert von Tamedia eine Korrektur sowie Entschuldigung wegen des angeblichen Image-Schadens für die PV-Branche. In Deutschland zeige sich mit EU-Recht sogar eine vorteilhaftere Förderung. Doch der Vergleich hinkt, weil Deutschland EU-Mitglied ist und EU-Recht mitgestaltet, während die Schweiz es im Abkommen nur übernehmen müsste. Fixe Mindestvergütungen wie 6 Rp wären so nicht haltbar, weil die Schweiz sie im Anhang III nicht abgesichert hat LinkedIn.
Roger Nordmann behauptet, dass die Sonntagszeitung falsch berichte. Das Stromabkommen verlange keine Abschaffung der Mindestvergütung, kleine Anlagen seien durch EU-Recht geschützt, und die 6 Rp seien im Schweizer EnG gesichert. Er übersieht, dass nicht die Erneuerbaren-Richtlinie massgeblich ist, sondern die VO (EU) 2019/943 und das EU-Beihilferecht: Sie erzwingen Marktpreislogik, wodurch fixe Mindestvergütungen wie die 6 Rp nicht haltbar sind. Deshalb hat der Bundesrat sie im Entwurf auch gestrichen LinkedIn.
Markus Flatt bemüht den Begriff “Falschinformation” und behauptet, dass das Abkommen keine Abschaffung der Förderung verlange. Mindestvergütungen seien nicht EU-widrig und der „Inlandvorrang“ sei nur ein Vorschlag des Bundesrats. Er blendet aus, dass VO (EU) 2019/943 und das EU-Beihilferecht Marktpreislogik erzwingen. Deshalb hat der Bundesrat die Minimalvergütung im Entwurf gestrichen LinkedIn.
Die Sachlage ist klar.
Was ich gelesen und verstanden habe:
EnG 30.9.2016 (Stand 1.1.2026) Art. 15 Absatz 1: «Netzbetreiber haben ... zu einem schweizweit harmonisierten Preis zu vergüten.» / Absatz 1bis «Der Bundesrat legt für Anlagen mit einer Leistung < 150 kW Minimalvergütungen fest.» - Darauf bezieht sich Art. 12 EnV 1.11.2017 (Stand 1.1.2026) mit den besagten 6 Rappen.
EnG 30.9.2016 (Stand 1.1.2025) Art. 15 Absatz 1: «Netzbetreiber haben in ihrem Netzgebiet ... zu vergüten ...» - Darauf bezieht sich Art. 12 EnV vom 1.11.2017 (Stand 1.5.2025) ohne Minimalvergütung.
Bundesbeschluss (Vorentwurf Vernehmlassung) Art. 15 Absatz 1: Hat zwar eine Vergütung für Anlagen mit einer Leistung < 200 kW festgelegt, aber keine Minimalvergütungen mehr. Sie richtet sich nach dem Markt und folgt damit der VO (EU) 2019/943, sie könnte also auch negativ sein.
Im Stromabkommen Anhang I ist die 4. EU-Rechtsakte VO (EU) 2019/943 integriert. Dieses EU-Gesetz würde somit auch in der CH gelten, Art. 3a «Preise werden auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage gebildet» sowie b und Erwägungsgründe 6 und 7.
Die Streichung der Minimalvergütung ergibt sich zwingend aus der Marktlogik der VO (EU) 2019/943 und dem EU-Beihilferecht.
Schiesst der Bund übers Ziel hinaus?
Fabian Schäfer doppelt am 2.9.2025 in der NZZ nach (Link):
Er führt an, dass die 2024 gesetzliche Mindestvergütung von 6 Rappen auch bei negativen Preisen mit dem Stromabkommen nicht EU-kompatibel seien. Nach einer Übergangsfrist von drei Jahren müsse sie gestrichen oder angepasst werden.
Die NZZ weist darauf hin, dass der Bundesrat weiter gehen will, als das EU-Recht verlangt: Das BFE argumentiere mit Markt- und Finanzierungslogik und nimmt die bundesrätliche Verordnung in der EnV (Stand 1.1.2026) wieder zurück.
Straumanns Entzauberung.
Das Paket Schweiz-EU, das niemand mehr bestellt hat.
Das NZZ-Interview von Katharina Fontana und Fabian Schäfer mit Tobias Straumann ist sehr lesenswert, weil es die Situation der Schweiz präzise erfasst.
Straumann entzaubert das wirtschaftliche Versprechen des Pakets Schweiz-EU: Der Marktzugangsvorteil werde überschätzt und sei in vielen Branchen kaum spürbar. Selbst in der Medtech-Branche seien die Mehrkosten nach Wegfall der Anerkennungsabkommen minimal (etwas über 0,1 % Umsatz). Für ihn ist klar: Das Paket ist kein ökonomischer Deal.
Seine Diagnose geht tiefer: Das Abkommen ist ein Projekt politischer Integration. Es bedeute Verlust an Souveränität, Abbau direkter Mitsprache und Angleichung an EU-Regulierung ohne relevanten Nutzen. Er erkennt zugleich die Wachstumsmüdigkeit der Bevölkerung. Im Gegensatz zum Integrationsfieber der 1990er Jahre sei ein weiterer Ausbau der Zuwanderung innenpolitisch nicht mehr tragfähig.
Straumann weist darauf hin, dass die Schweiz den Mut verliere und in vorauseilenden Gehorsam verfalle. Sein Satz: «Ich würde nicht auf Vorrat Ja sagen aus Angst vor negativen Folgen» trifft einen Nerv. Er bestätigt damit den Status quo für die Beziehungen mit der EU und stellt sich kritisch gegen das Paket Schweiz-EU.
Unser Fazit: Straumann bestätigt uns, warum das Paket Schweiz-EU nicht trägt. Die ökonomische Begründung überzeugt nicht und die politische bedeutet einen unnötigen Verlust an Souveränität. Zugleich ortet er bei der Bevölkerung eine Wachstumsmüdigkeit, die wir als klares Signal für mehr Qualität statt Quantität im Wachstum verstehen: Das Paket Schweiz-EU ist ein Projekt, das niemand mehr bestellt hat, weil es den Zeitgeist nicht mehr trifft.
#paketeuch #EU #politik #schweizsicht #vielseitigunabhängiggut
«Wir ergänzen uns gut».
Das erste Interview mit der FDP-Doppelspitze.
Pünktlich um 18:00 Uhr erscheint in der NZZ das erste Interview mit der künftigen Doppelspitze der FDP Schweiz. Immerhin musste nicht mit Filippo Leutenegger der Landsturm übernehmen, das liberale Enfant terrible Nicolas Rimoldi einspringen oder schlicht der scheidende Präsident Thierry Burkart in die Verlängerung gehen. All diese Schmach hat die Partei gerade noch abgewendet, nachdem vor vier Tagen auch der letzte Einerkandidatur-Favorit Damian Müller abgesagt hatte.
Wenn auch kunstvoll ignoriert, die Botschaft bleibt: Die einst staatstragende Partei schafft es offensichtlich nicht mehr, starke Persönlichkeiten für das Präsidium zu finden. So müssen es also Susanne Vincenz-Stauffacher und Benjamin Mühlemann richten. Sie wird das Paket Schweiz-EU unterstützen, er weiss es noch nicht. Man bekommt direkt etwas Mitleid mit den beiden, wenn man ihnen zuhört, wie sie treuherzig ihr Antrittsinterview geben. Im Wissen, was auf sie zukommt und wie jetzt die Partikularinteressen beispielsweise der Medtech-Branche rücksichtslos durchgedrückt und mit guter Miene zum bösen Spiel akzeptiert werden.
Unsere Prognose ist klar: Am 18.10.2025 wird die Partei a) das Doppelpräsidium bestätigen, b) das Paket Schweiz-EU unterstützen und c) nach den Wahlen 2027 ihren zweiten Bundesratssitz abgeben. So funktioniert er also, dieser ominöse Reset-Knopf. Es ist der Schleudersitz des zweiten FDP-Bundesratssitzes.
Datum: 20.8.2025 | Post: LinkedIn | Artikel: NZZ
Sehr geehrter Herr Thierry Burkart.
Bürgeranfrage an den FDP-Parteipräsidenten zur überfälligen Klärung zur Geltung von EU-Recht.
Sie sind mein Standesvertreter in Bern. Ich habe Sie gewählt, weil ich Ihre überlegte und sachliche Art sehr schätze. Auch hat mich Ihre kompetente Arbeit als FDP-Parteipräsident stets überzeugt.
Die Diskussion um das Paket Schweiz-EU ist an einem zentralen Punkt blockiert: der dynamischen Rechtsübernahme. Die Erläuterungen des EDA dazu sind unklar. Eine sachliche Klärung fehlt bisher. Das ist in dieser Frage nicht hinnehmbar, weil aus meiner Sicht die Folgen für unser Land gravierend sein können und der Sachverhalt für die laufende Vernehmlassung entscheidend ist.
Die EU kennt meines Wissens Verordnungen (direkt gültig) und Richtlinien (Umsetzung ins Landesrecht). Für die Schweiz heisst das: Die Integrationsmethode entspricht Verordnungen, der Äquivalenzansatz analog Richtlinien. Im Paket gilt die Integrationsmethode in den heiklen Bereichen Strom, Freizügigkeit, Lebensmittelsicherheit und Luftverkehr.
Das bedeutet: Hunderte Seiten EU-Recht (zum Beispiel gemäss EUR-Lex 742 Seiten im Freizügigkeitsabkommen, 796 Seiten im Stromabkommen) würden direkt und verbindlich in der Schweiz gelten, ohne dass sie je in unseren Gesetzbüchern stünden.
Das entspricht in etwa dem gesamten Umfang unserer zentralen Schweizer Bundesgesetze (Bundesverfassung, Obligationenrecht, Straf- und Zivilgesetzbuch, Straf- und Zivilprozessordnung).
Wir benötigen jetzt Klarheit. Ich bitte Sie deshalb, beim EDA einzufordern, wie genau diese Rechtsübernahme verbindlich ausgestaltet sein soll und wie das Verständnis der EU dazu ist. Konkret soll der Sachverhalt sowohl allgemein als auch exemplarisch an folgenden beiden EU-Rechtsakten dargestellt werden:
Freizügigkeitsabkommen: Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004.
Stromabkommen: Verordnung (EU) Nr. 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019.
Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen und stehe für einen Austausch gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Roland Voser
Grundlagen zu den Ausführungen:
https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-timeout
https://www.smartmyway.ch/paketeuch-vt6/#entry-R-1
https://www.smartmyway.ch/paketeuch-vt1/#entry-14
Weitere Analysen und Kommentare:
https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-bv
https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-strominhalt
https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-utopie
https://www.smartmyway.ch/about/paketeuch-pfzkompass
Datum: 18.8.2025 | Post: LinkedIn
EU-Verträge: Neue Regeln aus Brüssel gelten direkt in der Schweiz.
Die NZZ bringt die Integrationsmethode ans Licht.
Möglicherweise ist nicht allen bewusst, was Katharina Fontana in ihrem Artikel vom 8.7.2025 offengelegt hat:
„Die in Brüssel beschlossenen Rechtsakte werden unmittelbar Teil des Schweizer Rechts. «Diese Rechtsakte werden von der Schweiz grundsätzlich direkt angewendet, ohne dass sie in das Landesrecht überführt werden müssen», schreibt der Bundesrat in seinen Erläuterungen."
Allein im Stromabkommen sind es 20 Rechtsakte (Anhang I) mit 796 Seiten, die nach der Integrationsmethode direkt in der Schweiz gelten, ohne CH-Gesetzgebungsprozess. Für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sind sie mit Annahme des Pakets verbindlich.
Es ist schleierhaft, wie damit künftig Rechtssicherheit gewährleistet werden soll: Wie sollen wir in der Schweiz plötzlich auch Gesetze aus der EU berücksichtigen, ohne dass sie in Schweizer Gesetzesbüchern auffindbar sind?
Heikel sind auch spätere Änderungen. Will die Schweiz diese nicht übernehmen, muss sie reagieren und den Konflikt eskalieren, und zwar in ein Schiedsgerichtverfahren, in dem der EuGH das betroffene EU-Recht auch für die Schweiz verbindlich auslegt.
Hinzu kommen im Stromabkommen Anpassungen gemäss Beschlussvorlage des Bundesrates und ordentlichem CH-Gesetzgebungsprozess nach dem Äquivalenzansatz im Umfang von weiteren 26 Seiten Änderungen im Schweizer Recht (z.B. Umwelt Anhang V und Erneuerbare Anhang VI).
Es würde mich nicht wundern, wenn in den Kommentaren zu diesem Post hitzige Auseinandersetzungen entstehen, denn dieser Sachverhalt kann die vorgesehene EU-Integration der Schweiz kippen. Daher sagen wir auch, dass es als absolute Mindestforderungen für dieses Paket bei der Übernahme von EU-Recht für die Schweiz ein Veto ohne Wenn und Aber benötigt.
Brisant ist, dass mit einer Annahme des Pakets Artikel 190 der BV greift, der das integrierte EU-Recht als Völkerrecht über die Bundesverfassung stellt. Diese EU-Rechtsakte sind damit ab diesem Zeitpunkt nicht mehr rückgängig zu machen. Ausser bei Kündigung des Stromabkommens.
Unverständlich ist, dass es nach einem Monat noch keine Stellungnahme dazu aus Bern gibt. Und offen gesagt: Selbst diese würde mir nicht mehr reichen. Nur die EU kann der Schweiz jetzt sagen, was in diesem Punkt Sache ist.
Grossens Freude währt nicht lange.
Da war sie wieder weg, die minimale Einspeisevergütung.
Da hatte sich doch Jürg Grossen so gefreut und ich mit ihm. Noch heute steht es schwarz auf weiss: «Grünliberale feiern Erfolg: Der Bundesrat geht über die Bücher und spricht mehr Geld für Solarstrom.» Gemeint war die neue Minimalvergütung von 6 Rappen pro kWh für kleine Photovoltaikanlagen. Ein Mindestmass an Fairness gegenüber den vielen Kleinerzeugern, die mit hohen eigenen Investitionen zur Energiewende beitragen.
Doch im Bundesbeschluss über die Genehmigung und Umsetzung des Abkommens zwischen der Schweiz und der EU über Elektrizität ist davon nichts mehr zu lesen. Der frisch beschlossene Absatz in Art. 15 EnG, wonach «der Bundesrat für Anlagen mit einer Leistung von weniger als 150 kW Minimalvergütungen festlegt», verschwindet wieder, bevor er 2026 überhaupt Wirkung entfalten kann.
An seine Stelle tritt die Binnenmarktlogik des Stromabkommens aus dem Paket Schweiz-EU. Neu gilt: Grundversorger haben angemessen zu vergüten. Bei Nichteinigung richtet sich die Vergütung nach dem Marktpreis im Zeitpunkt der Einspeisung. Also können die Kleinen wieder zur Kasse gebeten werden, wenn der Strom negativ wird? Fairness wird durch Marktmechanik ersetzt.
Man kann sagen, die kleinen PV-Produzenten seien eine Minderheit und für ihr Schicksal selbst verantwortlich. Aber so einfach ist es nicht. Die Energiewende ist ein politisches Projekt des Bundes. Sie ist Teil der arg mangelhaften Energiestrategie 2050 und wurde nicht von den Kleinen angestossen. Wer den Beitrag dieser Pioniere will, muss ihnen auch faire Rahmenbedingungen gewähren.
Der Schluss liegt nahe: Das Stromabkommen macht in diesem masslosen Brüsseler Durchgriff bis zum letzten Schweizer Photovoltaik-Modul keinen Sinn. Wer ein solches Abkommen befürwortet, kennt zumindest die Realität der kleinen Stromkonsumenten und PV-Produzenten nicht. Es ist ein gelungenes Beispiel, dass ein erfolgreicher dezentral aufgebauter Kleinstaat wie die Schweiz in der EU nicht glücklich werden kann. Schon gar nicht ohne Mitbestimmungsrecht.
Datum: 9. August 2025 | Post: LinkedIn | Website: GLP
Eric Gujer zu Trump, Schweiz und EU.
Eine Antwort von mir zurück.
Eric Gujer schreibt am Schluss des NZZ-Artikels:
"Eine allein auf den Souveränitätsverzicht fokussierte Debatte über das mit Brüssel ausgehandelte Vertragspaket greift zu kurz. Die Überlegung, wie sich die Schweiz in der neuen Weltunordnung positioniert, gehört zwingend dazu. Eine enge Zusammenarbeit mit der EU ist eine Rückversicherung in einer unberechenbaren Welt. Wer das nicht wenigstens in Betracht zieht, hat aus dem Debakel mit Trump nichts gelernt."
Ich antworte ihm:
„Wenn wir aus der neuen Weltordnung etwas gelernt haben, dann, dass Staatswillkür heute selbst in repräsentativen Demokratien allgegenwärtig ist. In den USA regiert Donald Trump faktisch durch. 20 Jahre Merkel und eine fehlgesteuerte Ampel haben Deutschland an den Rand des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ruins geführt. Die Folgeregierung Merz steckt mit ihrer SPD in Dauerblockade und beansprucht für Deutschland die Führungsrolle in der EU. Diese falsche Sicherheit kann nicht ernsthaft die Zukunft der Schweiz sein. Unser Garant gegen Staatswillkür und für unseren Erfolg ist die direkte Demokratie. Daran muss sich alles ausrichten, weil sie die Menschen schützt.“
Datum: 8. August 2025 | Post: LinkedIn | Artikel: NZZ
Wenn eine Aussage ins Auge springt.
Der Automatismus ist nicht verstanden.
Interessanter Artikel in der NZZ zu den bundesrätlichen Schwierigkeiten im Umgang mit den Nachteilen des Pakets Schweiz-EU.
Doch eine Aussage des Autors springt ins Auge:
„Dazu gehört das Gerede von der «automatischen» Rechtsübernahme, obwohl die Verträge sehr klar sind: Es gibt keinen Automatismus, ohne ausdrückliche Zustimmung der Schweiz in jedem einzelnen Fall wird gar nichts übernommen."
Wenn der Autor die Verträge gelesen hätte, würde er differenzierter antworten. Diese Aussage ist unseres Erachtens nicht haltbar und wir haben im Artikel dargelegt wieso (Link).
Datum: 2. August 2025 | Post: LinkedIn | Artikel: NZZ
Zur Abschaffung der Geldgarantie bei Solaranlagen.
Dazu eine konträre Sicht.
Auch in diesem Thema darf man unterschiedlicher Meinung sein. Die fragwürdige Energiestrategie 2050 des Bundes hat Probleme verursacht, die der Bund jetzt auch lösen soll.
Seine Experten und Politiker haben das Speicherproblem (egal ob Tag/Nacht oder Sommer/Winter), die Ablösung der Fossilen, die Zunahme des Strombedarfs und die Importabhängigkeit unterschätzt.
Im Gegenzug haben die "Kleinen" getan, was Regierung und Politik von ihnen verlangt haben. Sie haben folglich die letzten Jahre erheblich investiert.
Jetzt soll das auch wieder nicht recht sein?
Wir sprechen inkl. Batteriespeicher und E-Mobilitätsanschluss für eine kleinere Anlage rasch über 40-50'000 Franken. Die Förderung ist heute erfahrungsgemäss nicht mehr nennenswert. Durch ihre eigene Erzeugung und den Eigenverbrauch sparen die kleinen Stromproduzenten in der Kombination substantiell Strom der Allgemeinheit ein, der nun für andere zur Verfügung steht. Das trifft so gesehen auch für die Netzbelastung zu.
Natürlich stimmt das nicht für das ganze Jahr oder einzelne Stromspitzen, beim raschen Laden des Elektroautos beispielsweise. Aber vielleicht für 8 Monate im Jahr passt das durchaus.
Die restlichen 4 Monate, ja stimmt. Da muss der Staat liefern. Wofür haben wir ihn denn sonst, wenn nicht für Aufgaben, die Einzelne nicht selbst bewältigen können? Das ist seine Grundaufgabe.
Doch ich sehe nichts, ausser eine gegenseitige Blockade in der Berner Bundespolitik. Und unkoordinierte Einzelmassnahmen in den Kantonen, die ihre Energiegewinne ihrer EWs umso mehr zu Lasten der Stromkonsumenten und kleinen Stromproduzenten schützen und konsequent durchsetzen.
Seit der Abstimmung über das Energiegesetz hat sich beim Bund meines Erachtens nicht viel getan. Daher erlaube ich mir hier die Verlinkung unseres damaligen Artikels dazu (Link).
Mischen Sie sich ein!
Unser Appell zum 1. August - Oder, wenn eine politische Frage die FDP zerreisst.
Wie Sie auch dazu stehen, wir bitten Sie: Mischen Sie sich jetzt ein. Denn es geht um die Schweiz. Unsere Heimat, der wir so viel verdanken.
Egal wie Sie es nennen, ob Rahmenabkommen, Bilaterale III oder Paket Schweiz-EU. Eines bleibt gleich: In den Bereichen Freizügigkeit, Strom, Lebensmittelsicherheit und Luftverkehr würde künftig EU-Recht direkt auf Schweizer Hoheitsgebiet gelten. Ohne Mitbestimmung. Ohne demokratischen Gesetzgebungsprozess. Das ist inakzeptabel und in aller Schärfe zurückzuweisen.
Denn damit steuert die EU neu die Versorgungssicherheit, die innere Stabilität, den Markt und letztlich unseren Wohlstand. Wer dazu Ja sagt, hat das Paket nicht verstanden. Und vergessen, was den Erfolg der Schweiz ausmacht. Flexible Selbstbestimmung, kluge Eigenverantwortung und demokratische Kontrolle.
Freiheit ist nicht Selbstzweck. Sie ist unverzichtbar. Sie ist der Schlüssel zum Erfolg, indem Menschen ihr Leben eigenverantwortlich gestalten, Leistung erbringen und so echten Mehrwert schaffen. Davon profitiert am Ende das Kollektiv, insbesondere auch die Schwächeren und damit unser ganzes Land. Das dezentrale System der Schweiz ist dafür die beste Grundlage. Sie hat es bewiesen. Die zentralistische EU ist das pure Gegenteil davon.
Der Verlust an Souveränität wiegt schwerer als jeder mögliche Vorteil dieses Pakets. Wenn wir unsere Zukunft aus der Hand geben, werden wir uns aufgeben.
Informieren Sie sich jetzt. Die Diskussion ist im Gange, wie die Kontroversen in der FDP zeigen. Wir legen Ihnen dazu unseren Appell zum 1. August ans Herz.
Lesen Sie ihn hier (deutsch: Link | italiano: Link) und bekennen Sie Farbe: Rotweiss oder Blaugelb im Kommentar genügt.
Datum: 24. und 26. Juli 2025 | Post: LinkedIn
Doch es geht um die Verträge.
Eine Antwort an Simon Michel.
Doch, es geht um die 13 Verträge und zwar primär und von der Bedeutung quasi ausschliesslich. Hier haben wir einen klassischen Fall von feiner Manipulation. Es soll der Eindruck erweckt werden, dass die Verträge nicht mehr zur Diskussion stünden und nun ein ganz normaler Gesetzgebungsprozess ablaufen wird. Was natürlich nicht der Fall ist.
In der Medienmitteilung vom 13. Juni 2025 eröffnet der Bundesrat die Vernehmlassung zum Paket Schweiz-EU. Darin führt er zuerst die 13 paraphierten Staatsverträge auf, erst danach folgen die Umsetzungsgesetze (Link). Damit sind die Verträge Teil der Vernehmlassung und stehen auf dem Prüfstand. Nicht mehr und nicht weniger.
Das ist auch richtig so. Wir müssen die Verträge prüfen. Die Umsetzung ist unnötig, wenn die Verträge nicht sinnvoll sind. Dann kann man sich die Diskussion über die 35 Gesetze sparen. Insbesondere, wenn nach der Annahme EU-Recht bei Freizügigkeit, Elektrizität, Lebensmittelsicherheit und Luftverkehr an diesen Gesetzen vorbei auf Schweizer Hoheitsgebiet gelten würden.
Ich würde mir wünschen, dass die Diskussion fair und faktenbasiert abläuft. Denn sie hat es verdient. Es geht hier in dieser Frage darum, wie wir gemeinsam diesen möglichen weitreichenden Systemwechsel beurteilen und entscheiden wollen. Diese Fairness erwarte ich auch von Politikern und Milliardären.
Post: LinkedIn
Kein Durchblick beim Freizügigkeitsabkommen.
Die Situation mit den Änderungsprotokollen ist intransparent und inakzeptabel.
Wie bitte – kein kompletter Vertragstext, gerade beim Freizügigkeitsabkommen?
Parlament, Interessengruppen, Verbände, Bürgerinnen und Bürger und viele mehr sollen das neue Freizügigkeitsabkommen aus dem Paket Schweiz–EU beurteilen. Man würde meinen, ein solch weitreichender Staatsvertrag liege in vollständiger, integrierter Form vor. Denn es ist klar: Nur der komplette Vertragstext ist für eine Beurteilung entscheidend. Alles andere wäre Schattenboxen oder Polittheater.
Doch das vollständige zukünftige Abkommen liegt nicht vor. Mich überrascht dieses Defizit angesichts der bisher gelieferten Qualität nicht. Beim Stromabkommen haben wir eine zweite Lücke geschlossen und wenigstens eine online lesbare Version dieses kompletten Staatsvertrages zur Verfügung gestellt (Link).
Beim Freizügigkeitsabkommen hingegen fehlt alles. Wer den heutigen Stand verstehen will, muss sich den Text aus verschiedenen Quellen selbst zusammensetzen:
den Originalvertrag vom 21. Juni 1999 (in Kraft seit 1. Juni 2002)
das Protokoll I zur Erweiterung auf die EU-10 (2004)
das Protokoll II zur Erweiterung auf Bulgarien und Rumänien (2008)
das Protokoll III zur Erweiterung auf Kroatien (2016)
die relevanten Beschlüsse des Gemischten Ausschusses:
Beschluss 1/2006 (soziale Sicherheit)
Beschluss 1/2012 (neuer Anhang II)
Beschluss 1/2017 (technische Anpassungen Kroatien)
und das Änderungsprotokoll vom 13. Juni 2025 (199 Seiten), das das Abkommen in zentralen Punkten neu schreibt.
Wie soll unter solchen Bedingungen eine Vernehmlassung über ein Staatsvertragsbündel erfolgen (bei dem das Freizügigkeitsabkommen nur einer von sieben bis acht Staatsverträgen ist), das rechtlich, politisch und gesellschaftlich für die Schweiz derart weitreichend ist?
Darf man angesichts dieser Vorgehens- und Arbeitsweise den ganzen Vorgang zurück an den Absender schicken? Wäre ein Nein nicht die einzig sachgerechte Reaktion? Vielleicht gerade ein Nein zum ganzen Paket – denn offenbar ist es ja nicht einmal wichtig genug, dass man es vollständig zugänglich macht?
Klar ist jedenfalls: Niemand wird dieses Paket in seiner relevanten Form tatsächlich gelesen geschweige denn verstanden haben – denn es liegt gar nicht vor. Sorry, diese Nachlässigkeit nervt mich nur noch. So geht Demokratie nicht.
Ist meine Kritik nachvollziehbar? Oder bin ich zu hart mit unserer Regierung und den Bundesstellen, die für diese Vorlage verantwortlich sind?
Post: LinkedIn
Wir wagen uns ans Unmögliche.
Die Tragweite ist zu gross, um nicht einzusteigen.
Wir haben das Paket Schweiz–EU analysiert – soweit das Normalsterbliche angesichts der 1'117 Seiten EU-Originaltext und der kaum überblickbaren Komplexität überhaupt tun können. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir dem Bundesrat unser Feedback mitgeben und an der Vernehmlassung teilnehmen werden. Denn es geht unseres Erachtens um die Seele der Schweiz – nicht mehr und nicht weniger. Politiker kommen und gehen, der Souverän bleibt und muss mit ihren Entscheidungen leben. Die Alternative, blindes Vertrauen in die Gewählten, genügt bei einer Frage dieser Tragweite nicht mehr.
Heute haben wir deshalb eine Medienmitteilung veröffentlicht. Ihr könnt sie in unserem Artikel nachlesen.
Auf den Punkt gebracht: Das vorliegende Paket Schweiz–EU hat für die Schweiz aufgrund seiner institutionellen Anbindung zu grosse Nachteile: Wer kann schon gut finden, dass die EU Recht erlassen kann, dass direkt in der Schweiz gilt? Es muss nachverhandelt werden. Die rote Linie: Keine institutionelle Anbindung, die die Schweizer Souveränität tangiert und Art. 2 der Bundesverfassung nicht vorbehaltlos respektiert. Für diesen nächsten Schritt ist ein neues Setting nötig – und eine departementsübergreifende Taskforce unter externer Leitung überfällig.
Wir sind auf die Reaktionen gespannt. Wie denkt ihr dazu?
Hier geht’s zum Artikel, zur Medienmitteilung und zur Detailanalyse (Link)
Post: LinkedIn
Rotweiss aufgeben?
Wir sind die Schweiz.
Ein Verlag, der politisch Stellung bezieht – das ist schwierig. Vor allem ohne Kampagnenkasse. Aber wir tun es trotzdem. Weil wir uns ehrlich Sorgen machen.
Wieso? Weil das neue Paket Schweiz-EU zur Makulatur wird, wenn die EU es im Nachhinein ohne Einverständnis der Schweiz zu ihren Gunsten ändern kann.
Diese Frage ist matchentscheidend – für ein Ja oder Nein. Und für die Zukunft der Schweiz.
Wir haben uns tief in die Materie eingearbeitet – und sind nicht wegen der 1117 Seiten Vertragstext der vorliegenden relevanten 13 Änderungs- und Zusatzprotokolle sprachlos, sondern wegen der fragwürdigen institutionellen Anbindung, die der Bundesrat uns vorlegt. Denn wir sind die Schweiz und nicht Teil der EU ohne Mitbestimmungsrecht.
Ja, wir wollen Europa – mit exzellenten Beziehungen zu unseren Nachbarn. Aber nicht zu diesem Preis.
Hier unsere Analyse & offenen Fragen (Link).
Hier das Summary und unser Feedback an den Bundesrat (Link).
Wir lassen uns gerne umstimmen – mit guten Argumenten. Auch wenn die EU mit ihren Hürden für kleine Verlage bisher eher Nachteile brachte: Newsletter-Marketing und Vertrieb nach Deutschland sind insbesondere wegen der DSGVO und der hohen Kosten unrealistisch.
Konstruktive Meinungen sind willkommen. Was denkt ihr dazu?
Post: LinkedIn
Die Schweiz in der Wachstumsfalle. Warum mehr vom Gleichen nicht reicht.
Das BIP pro Kopf hat sich seit 2006 nahezu verdoppelt, in den letzten zehn Jahren stagnierte aber das verfügbare Einkommen pro Kopf. Der Wohlstand der Schweiz wächst nicht im Portemonnaie der Menschen. Das ist nicht zukunftsfähig.
(c) 2016: Morcote, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Was Sie sagen müssten, wenn Sie Bundesrat wären.
Mit dem Paket Schweiz-EU will Brüssel gleiche Regeln für alle. Wenn Sie Bundesrat wären, müssten Sie erklären, dass dies für die Schweiz zwar Marktzugang und planbare Kooperation bringt, aber auch Rechtsübernahme ohne Mitbestimmung. Ihnen wird klar: Das ist eine Zäsur mit Folgen für Demokratie und Wohlstand.
(c) 2019: Monte Boglia, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Freizügigkeit ohne Kompass.
Die Schweiz funktioniert. Sehr gut sogar. Warum funktioniert das Paket Schweiz-EU aus unserer Sicht nicht überzeugend? Wir sagen: Erst das Ziel, dann die Regeln.
(c) 2023: Lago di Lugano, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Die Schweiz. Eine Utopie für Europa?
Mit dem Paket Schweiz-EU schlägt der Bundesrat einen Weg ein, der langfristig zur Anpassung ans europäische Mittelmass führen könnte. Dabei wäre das Gegenteil sinnvoll. Nicht die Schweiz sollte sich der EU angleichen. Europa sollte sich ein Beispiel an der Schweiz nehmen.
(c) 2023: Luganese, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Das Stromabkommen. Passt die Lösung zum Problem?
Das Stromabkommen aus dem Paket Schweiz-EU stellt Importgarantie und Souveränität zueinander ins Spannungsfeld. Nach der institutionellen Betrachtung prüfen wir, wie es aus Bürgersicht inhaltlich abschneidet. In unserem Fazit fragen wir uns, wie so eine Vorlage entstehen konnte.
(c) 2017: Lisone, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Dieses Paket bricht mit der direkten Demokratie.
Das Paket Schweiz-EU stellt die direkte Demokratie der Schweiz in Frage. Nach dem EWR-Nein und dem Abbruch des Rahmenabkommens soll mit dem Paket Schweiz-EU jetzt alles anders sein. Wir sehen das nicht so und sagen: Es reicht! Und wir erklären, warum.
(c) 2015: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Paket Schweiz-EU: Time-out bitte.
Die Vernehmlassung zum Paket Schweiz–EU ist angelaufen. Ein positives Zeichen, denn die Diskussionen sind engagiert und erzeugen Resonanz. Die institutionelle Anbindung rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen. Eine Klärung würde der Vernehmlassung gut tun. Der vorliegende Artikel liefert den Anstoss dazu.
(c) 2013: Monte Generoso, Capolage, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz.
Das Paket Schweiz-EU würde unser Land grundlegend und unwiderruflich verändern. Es geht um die Frage wer künftig unser Recht bestimmt, Brüssel oder wir. Zum 1. August 2025 mein Appell: Mischen Sie sich ein. Unsere Heimat gehört den Menschen nicht der Politik. Ein Blick auf die FDP zeigt warum.
(c) 2017: Capanna Monte Bar, Capriasca, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Das Stromabkommen im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit.
Das neue Stromabkommen (Elektrizität) im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit ist ein zentrales Element des Pakets Schweiz–EU. Es offenbart im Perspektivenwechsel ein unerwartetes Ausmass an gegenläufigen Erwartungen der Vertragspartner. Wer eintauchen will, dieser Artikel ist die richtige Gelegenheit dazu.
(c) 2019: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Orginalwortlaut Stromabkommen - hier online verfügbar.
Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? Wir haben die 163 Seiten des Stromabkommens ordentlich strukturiert und im Originalwortlaut der EU auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Wir leisten damit einen Beitrag zur Lesbarkeit dieses Abkommens. Wir hoffen, dass viele so einen einfacheren Zugang dazu finden und unser Angebot nützlich ist.
Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint.
Ein umfassendes Paket von Abkommen zur Festigung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt jetzt auf dem Tisch. Es bildet die Grundlage für eine folgenschwere Entscheidung der Schweiz, die es ernsthaft auszuloten gilt.
(c) 2025, Schloss Wildegg, Möriken-Wildegg, Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser.
Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.
Hier finden Sie die Stellungnahme von smartmyway zum Paket Schweiz-EU im Rahmen der offiziellen Vernehmlassung.
(c) 2016: Gewittersturm, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
smartmyway unterwegs.
(c) 2017: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.
Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management