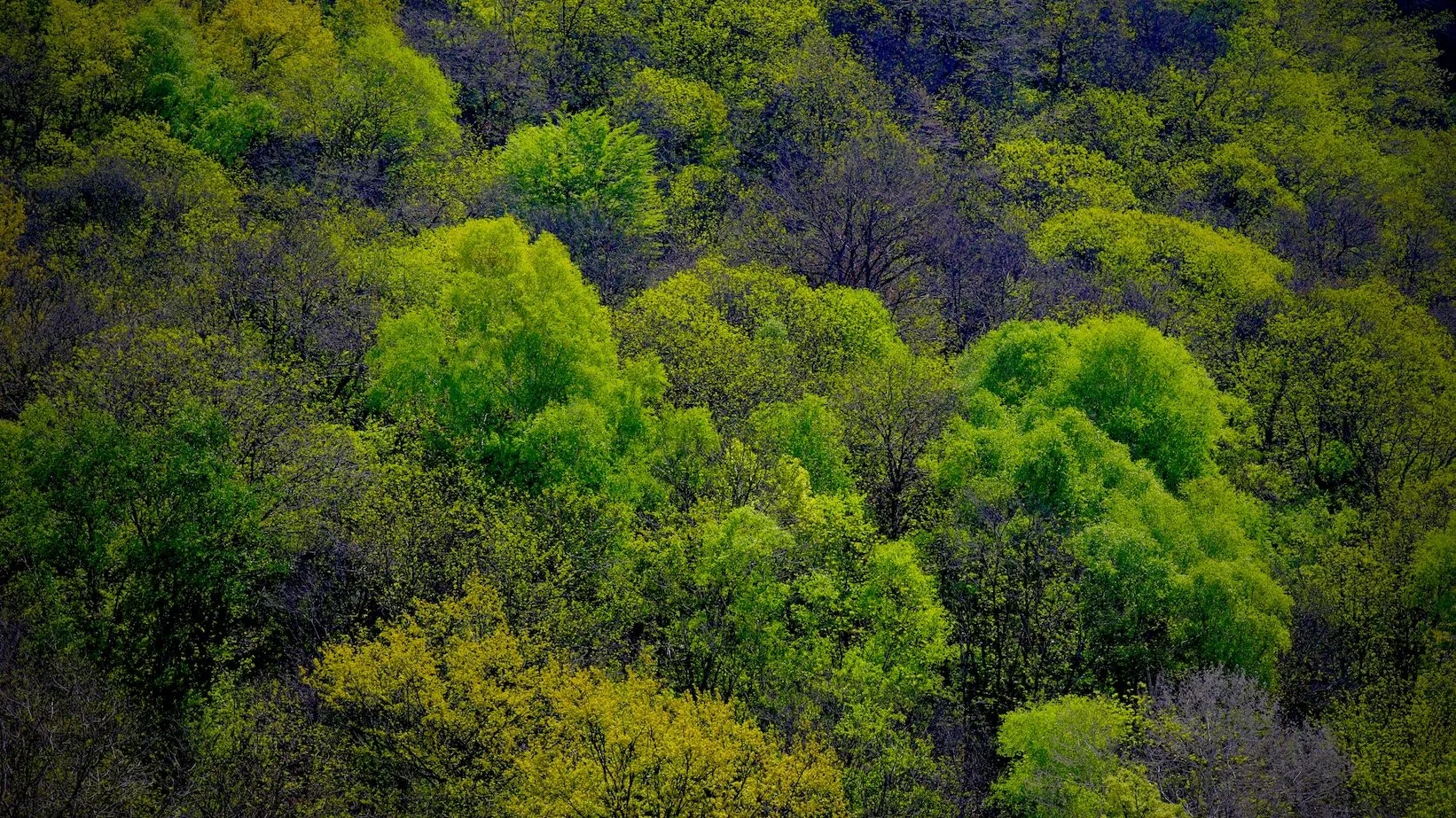Paket Schweiz-EU: Time-out bitte.

Die Vernehmlassung zum Paket Schweiz–EU ist angelaufen. Ein positives Zeichen, denn die Diskussionen sind engagiert und erzeugen Resonanz. Die institutionelle Anbindung rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen. Eine Klärung würde der Vernehmlassung gut tun. Der vorliegende Artikel liefert den Anstoss dazu.
Die Schweiz soll sich institutionell in die Europäische Union integrieren und damit besseren Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalten. Die damit verbundene Übernahme von EU-Recht ist über alle Abkommen hinweg ein wesentliches Element des neuen Pakets Schweiz-EU. Davon wird die Schweizer Gesetzgebung tangiert sein. Dieser Punkt ist der Grund, weshalb die Vernehmlassung jetzt Beachtung benötigt, weil die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes das letzte Mal vor der Paket-Abstimmung ihr Bürgerrecht wahrnehmen und dem Bundesrat ihre Haltung mit auf den Weg geben können. Er ist auch der Grund, warum bei diesem Thema nun die Wogen hochgehen.
Wir zeigen im Folgenden, wie aus unserer Sicht am Beispiel des Stromabkommens zentrale EU-Gesetze direkt und automatisch auch auf Schweizer Hoheitsgebiet gelten. Die Schweiz hat ferner ein Mitwirkungs-, aber kein Stimmrecht. Auch kein Veto ohne Wenn und Aber. Und im Streitfall legt der EuGH sein eigenes Recht aus. Gleichzeitig ist im Normalfall der nationale Gesetzgebungsprozess mindestens bei der Integrationsmethode unnötig. Die Heirat der Schweiz mit der EU wird unseres Erachtens sehr eng und in weiten Teilen praktisch nicht mehr auflösbar. So sagen wir: Wer das Paket trotzdem unterstützt, soll dies tun, aber in Kenntnis der Konsequenzen. Genau daran fehlt es unserer Meinung nach derzeit.
Der vorliegende Artikel führt aus Bürgersicht systematisch in die Problemstellung ein und nimmt trotz komplexer Materie eine verständliche Einordnung nach gesundem Menschenverstand vor. Dies erfolgt auf der Grundlage der in der Vernehmlassung verfügbaren Informationen. Im Gegenzug dazu besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Vielmehr ist er gedacht als sorgfältiger Impuls für die weitere Diskussion. Wir haben diese Arbeit durchgeführt, weil wir keine entsprechend verständliche Vorarbeit gefunden haben. Für Hinweise sind wir dankbar.
Roland Voser, smartmyway ag, 31. Juli 2025.
Hier finden Sie die Online-Quellen für folgende Themen: Vertragstext Freizügigkeitsabkommen, Vertragstext Stromabkommen, Lesehilfe EDA-Dokumente
Worum es uns geht.
Wir lehnen das Paket Schweiz-EU nicht grundsätzlich ab. Auch wir sehen, dass die bilaterale Zusammenarbeit mit der EU für die Schweiz wichtig ist. Doch wir sind überzeugt, dass das Erfolgsmodell der Schweiz auf ihrer eigenständigen, demokratisch legitimierten Regelsetzung beruht.
Mit der sogenannten Integrationsmethode erhält das Paket einen institutionellen Mechanismus, der unseres Erachtens diese Souveränität ernsthaft in Frage stellt. Dieser Mechanismus führt dazu, dass zentrale EU-Rechtsakte direkt und automatisch Teil der schweizerischen Rechtsordnung werden, inklusive künftiger Änderungen und Erweiterungen. “Teil der schweizerischen Rechtsordnung” heisst nichts anderes, als dass EU-Rechtsakte auch auf Schweizer Hoheitsgebiet gültig sind. Die Schweiz hätte dabei weder ein Vetorecht ohne Wenn und Aber noch effektive Kontrolle über die Entwicklung, wenn sie keine Eskalation riskieren möchte. Zusätzlich würden in diesem Fall die ordentlichen Gesetzgebungsprozesse der Schweiz unnötig. Genau diese Dynamik ist langfristig nicht absehbar, politisch heikel und entspricht zugleich der Richtung, in welche die EU die institutionelle Anbindung weiterentwickeln möchte.
Deshalb legen wir im Folgenden als Kritiker des Pakets und nicht als dessen Gegner den Schwerpunkt bewusst auf die institutionellen Elemente. Nicht um die europäische Zusammenarbeit abzulehnen, sondern um zu fragen, ob sie unter diesen Bedingungen tragfähig ist.
Die direkte Demokratie gibt uns das Bürgerrecht, hier mitzureden. Uns ist diese direkte Demokratie wichtig, und eine Veränderung wollen wir nicht leichtfertig vornehmen.
Einstieg.
Bevor sich Befürworter und Gegner vollständig in die Haare kriegen, sollten wir einen Schritt zurücktreten. Ein Time-out, quasi.
Am 13. Juni 2025 hat der Bundesrat die Vernehmlassung zum Paket Schweiz-EU eröffnet. Abgabetermin ist der 31. Oktober 2025. Dazwischen: Die Sommerferien. Nicht einmal ein halbes Jahr bleibt also, um sich in diesem hochkomplexen und äusserst leserunfreundlichen Thema zurechtzufinden. Eines ist klar: Niemand hat alle Unterlagen gelesen. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Weder die 1117 Seiten Vertragstext zu den 13 Abkommen, noch die 931 Seiten Erläuterungen des Bundesrats oder was sich sonst noch in diesem Papierberg verbirgt.
Schätzungshalber sprechen wir insgesamt wohl über rund 3000 Seiten, die die Vernehmlassungsadressaten zu bewältigen hätten. Wir redigieren im Fachlektorat in unserem Fachgebiet und bei vollem Tempo maximal 50 Seiten pro Tag. Um also den gesamten Umfang wirklich zu lesen und zu verstehen, braucht es rund 60 Arbeitstage. Das entspricht etwa drei Monaten in Vollzeit. Die Vernehmlassungsfrist beträgt zwar 4.5 Monate, doch unter realen Bedingungen ist das zu knapp bemessen. Die grosse Mehrheit versucht also logischerweise, sich ihre Meinung anhand von Zusammenfassungen oder schlicht mittels Diskussionen auf Social Media zu bilden. Also auf Basis von etwas, das andere bereits vorverdaut haben oder bewusst platziert wird.
Die offiziellen Entscheidungsgrundlagen des Bundesrates sind so gesehen schon rein vom Umfang her zurückzuweisen. Niemand würde in der Privatwirtschaft seinen Investoren einen solchen Papierstapel hinwerfen und dann eine Entscheidung über die Fusion eines Milliardenunternehmens verlangen. Hier stellt sich die Frage, ob der Bundesrat seinem Anspruch an bürgernaher oder wenigstens politiknaher Information gerecht wird. Die Inhalte sind komplex, die Dokumentenflut erdrückend, was die demokratische Meinungsbildung erheblich erschwert. Vielleicht sind es seine Beamten, die den Überblick und den Bezug zur Realität verloren haben. Die Informationslage ist jedenfalls kaum überblickbar, die Dokumente überladen. Die sorgfältige Analyse ist nahezu nicht mehr zu leisten. Dennoch soll die folgende Einordnung einen konstruktiven Beitrag zur öffentlichen Diskussion leisten.
In diesem Umfeld bewegen wir uns aktuell. Treten wir jetzt einen Schritt zurück und betrachten uns das Paket aus der Distanz.
Des Pudels Kern.
Natürlich hat dieses Paket zwei Seiten. Zweifellos enthält es viele materielle Aspekte, die eine Teilnahme am Binnenmarkt rechtfertigen. Und mit Sicherheit hat es entscheidende Verbesserungen drin. Beispielsweise ist die unsägliche Guillotine-Klausel gefallen. Die Bilateralen sind bestimmt eine Erfolgsgeschichte. Über solche einzeln greifbare Verhandlungsteile kann man in der politischen Diskussion unterschiedlicher Meinung sein und sie offen vertreten. Je nach Interessenlage überwiegen die Vor- oder die Nachteile, und der Punkt kann entweder positiv abgehakt oder begründet abgelehnt werden. So funktioniert das in jedem politischen Geschäft. Auch in Vernehmlassungen, nichts Neues also.
In einem Punkt ist das hier anders. Die institutionelle Anbindung greift ins Selbstverständnis der Schweiz ein. In die Identität seiner Menschen und in ihr Wir-Gefühl. Es geht darum, wie selbständig die Schweiz künftig ihre Regeln bestimmen will. Nicht mehr und nicht weniger. Diese Feststellung ist korrekt abgeleitet und sachlich richtig. Hier geht es nicht mehr um einzelne Vor- oder Nachteile, sondern um eine mögliche Neuausrichtung des Staatsverständnisses. Dass hier die Meinungen weit auseinander gehen, ist verständlich. Alles andere wäre äusserst irritierend.
Klar ist – und naiv, wer anderes glaubt –, dass genau diese Frage über das Paket entscheiden wird. Denn die Schweizerinnen und Schweizer wurden mürbe gemacht. Die ständigen Querelen mit der EU will niemand mehr. Auch die jahrzehntelange politische Diskussion soll endlich ein Ende haben.
Die Schweiz ist deshalb bereit, dafür zu bezahlen, dass andere mit ihr den Markt teilen dürfen. Ja, es gibt auch diese umgekehrte Betrachtung: Die Schweiz ist keine Nullnummer in Europa und darf sehr wohl Bedingungen stellen. Die EU kann auch am Schweizer Markt teilnehmen. Das Ganze ist gegenseitig. Die Schweiz ist jedoch eine gutmütige, friedliebende Nation und bereit, viel dafür zu opfern, um gutnachbarschaftliche Beziehungen zu pflegen.
Doch im Bereich der institutionellen Anbindung überschreitet dieses Paket für viele Menschen bei all der Euphorie fein spürbar eine rote Linie. Es ist nicht mehr einfach so klar, wie die Souveränität der Schweiz nach dem Abschluss des Pakets Schweiz-EU weiter uneingeschränkt, allgemein verträglich und wirkungsvoll ausgeübt werden kann. Die Frage ist nicht, ob sie noch da ist. Die Frage ist, ob die Schweiz noch frei, ohne Bedingungen und ohne Sanktionen, über ihr Hoheitsgebiet entscheiden kann. Diese Frage ist keine Fata Morgana. Kein Schachzug der Paketgegner. Keine – meinetwegen – Verschwörungstheorie.
Sie ist eine berechtigte Sorge. Und sie fordert Beachtung. Denn das Sensorium des staatspolitischen Verständnisses der Schweiz hat angeschlagen.
Aber es ist doch alles klar, wieso diese Aufregung?
Wir lesen in den Erläuterungen des Bundesrates (D-2):
«Die vorliegenden Abkommen sichern die verfassungsmässigen Kompetenzen der Kantone, der Bundesversammlung, des Bundesrates, der Gerichte und des Volkes. Die durch die Bundesverfassung garantierten Initiativ- und Referendumsrechte (Art. 136 Abs. 2 BV) sind weiterhin in vollem Umfang gewährleistet. Weder die einzelnen Abkommen noch die darin enthaltenen institutionellen Elemente verhindern, dass eine Volksinitiative lanciert werden kann [...] Ebenso wird gegen eine solche Rechtsübernahme [...] wie bisher das Referendum ergriffen werden können.»
Oder:
«Die Schweiz kann aufgrund der mit der EU abgeschlossenen Binnenmarkt- und Kooperationsabkommen gezielt an denjenigen Bereichen teilhaben, die ihren Kernanliegen dienen, ohne dass die Kompetenzen der Kantone, der Bundesversammlung, des Bundesrates, der Gerichte oder des Volkes eingeschränkt werden.»
Im Fragenkatalog finden wir 17 Fragen, die Bezug zur institutionellen Anbindung nehmen (siehe D-3). Alle werden abschlägig beantwortet. Also so, dass sich nichts ändern würde. Exemplarisch die Frage 2 vom Fragebogen: «Muss die Schweiz EU-Recht automatisch übernehmen?» Antwort: «Nein. Die Schweiz entscheidet im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Verfahren (z. B. Referendum), ob sie neues EU-Recht übernimmt oder nicht. Die dynamische Rechtsübernahme bedingt immer die Zustimmung der Schweiz. Automatisch passiert nichts.»
Alles in Ordnung?
Schauen Sie: Der Bundesrat befürwortet dieses Paket. Und auf rund 1000 Seiten, konkret in Erläuterungen (931 Seiten), Fragebogen (29 Seiten), Übersicht (21 Seiten) und Faktenblatt (5 Seiten), legt er dar, weshalb das Paket gut sei. Das ist verständlich. Ebenso nachvollziehbar ist, dass sich die Befürworter genau an diesen Dokumenten orientieren. Es hätte ihnen nichts Besseres passieren können. Sie können direkt daraus zitieren. Ein Beispiel: Die 95 EU-Rechtsakte (im Schweizer Umfeld als EU-Gesetzgebungsakte bezeichnet) finden sich gleich auf der ersten Seite im Punkt 2 des Dokuments „Übersicht EU-Gesetzgebungsakte“. Es seien nur 95, heisst es da. Das sei verkraftbar. Das könne die Schweiz leisten.
Also wieso diese Aufregung, fragen die Befürworter?
Es ist nicht so, sagen die Kritiker.
Die Kritiker können nicht einfach die Botschaft des Bundesrates übernehmen. Sie müssen sie sich selbst zusammenreimen. Die Dokumente des Bundesrates sind dazu unseres Erachtens zu unausgewogen. Sie benennen die Risiken nicht. Und wir werden fündig. Sie jetzt auch, denn Sie lesen im Überblick der EU-Gesetzgebungsakte (D-1) des Bundesrates:
«So sehen gewisse Abkommen (FZA, Luftverkehrsabkommen (Fussnote 6), Lebensmittelsicherheitsprotokoll, Anhänge I und VI StromA, Gesundheitsabkommen) vor, dass die EU-Gesetzgebungsakte durch ihre Integration in das jeweilige Abkommen Teil der schweizerischen Rechtsordnungen werden (sog. Integrationsmethode).»
Und:
«Andere Abkommen beruhen auf einem Äquivalenzansatz (MRA7, Landverkehrsabkommen (Fussnote 8), die Beihilfeüberwachung, Anhang V StromA [Umweltrecht]). Bei diesem Ansatz wendet die Schweiz die in den Abkommen integrierten EU-Gesetzgebungsakte nicht direkt an, sondern erlässt schweizerisches Recht, welches mit den jeweiligen EU-Gesetzgebungsakten äquivalent ist.»
So fragen die Kritiker zurück, was an der ersten Passage nicht klar sei. Was unklar sei an Formulierungen wie “durch ihre Integration” und “Teil der schweizerischen Rechtsordnungen”. Denn das heisst unmissverständlich: Eine EU-Gesetzgebungsakte, wenn sie im Abkommen aufgeführt ist, wird automatisch Teil des Schweizer Rechts. Sie gilt also ohne weiteres Zutun auch auf Schweizer Hoheitsgebiet.
Und Sie fragen weiter, was bei der Äquivalenzmethode im Ergebnis eigentlich anders sei. Denn da steht: Die Schweiz “erlässt schweizerisches Recht … das mit den jeweiligen EU-Gesetzgebungsakten gleichwertig ist”. Es steht nicht: Die Schweiz kann. Es steht: Die Schweiz erlässt. Diese Formulierungen stammen nicht von uns. Der Bundesrat hat das so im Wortlaut in seinem für die Rechtsübernahme zentralen Dokument festgehalten.
Im Faktenblatt zu den institutionellen Elementen (D-4) ist festgehalten:
«Wenn sich das Recht des EU-Binnenmarktes in Bereichen weiterentwickelt, die in den Geltungsbereich eines Binnenmarktabkommens fallen, dann integrieren die Schweiz und die EU diese Rechtsentwicklungen in das jeweilige Abkommen (sogenannte Verpflichtung zur dynamischen Rechtsübernahme) “Dynamisch” heisst aber nicht “automatisch”: D.h. die Schweiz entscheidet über jede Übernahme eines neuen relevanten EU-Rechtsaktes in ein Abkommen und die in diesem Zusammenhang allenfalls erforderliche Anpassungen im nationalen Recht eigenständig und gemäss ihren üblichen innerstaatlichen Verfahren, inklusive ihren direktdemokratischen Entscheidungsprozessen wie dem Referendum. Sie behält also die Kontrolle.»
Die Kritiker halten dem entgegen, dass die Aussage, die Schweiz behalte bei der dynamischen Rechtsübernahme die Kontrolle, bei der Integrationsmethode sachlich falsch ist. Wird ein EU-Rechtsakt in den Anhang aufgenommen, wird er automatisch Teil des schweizerischen Rechts. Eine Ablehnung führt zu Eskalation, möglichen Sanktionen und gegebenenfalls vorläufiger Anwendung. Ein echtes Vetorecht ohne Konsequenzen besteht nicht. Von uneingeschränkter Kontrolle kann aus dieser Sicht nicht länger die Rede sein.
Was gilt jetzt, fragen sich Befürworter und Kritiker?
Es gelten die Verträge.
Spätestens jetzt müssen wir die Verträge bemühen. Weil ausschliesslich sie relevant sind. Nicht die Erläuterungen des Bundesrates. Nehmen wir uns also nochmals die Frage 2 aus dem Fragebogen vor. Die Reaktion der Befürworter haben wir bereits analysiert: Sie wären zufrieden und sähen keinen Handlungsbedarf. Doch wie würden der Autor der Antwort und die Kritiker sie beurteilen?
Frage: «Muss die Schweiz EU-Recht automatisch übernehmen?» Antwort: «Nein. Die Schweiz entscheidet im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Verfahren (z. B. Referendum), ob sie neues EU-Recht übernimmt oder nicht. Die dynamische Rechtsübernahme bedingt immer die Zustimmung der Schweiz. Automatisch passiert nichts.»
Prüfen wir diese Antwort anhand des Stromabkommens. Es ist ein neues Abkommen, also liegt der Vertrag vollständig vor. Die institutionelle Wirkungsweise ist transparent und nachvollziehbar in einem Dokument geregelt (Link).
Wie hat der Autor die Antwort geschrieben?
Das Stromabkommen Artikel 27 Absatz 2 (V-V2) besagt: «Rechtsakte der Union, die gemäß Absatz 5 in die Anhänge I und VI integriert werden, werden durch ihre Integration Teil der Schweizer Rechtsordnung, gegebenenfalls vorbehaltlich der vom Gemischten Ausschuss beschlossenen Anpassungen.»
Artikel 28 Absatz 3 (V-V2) ergänzt: «Bis die Schweiz mitteilt, dass sie ihre verfassungsrechtlichen Verpflichtungen erfüllt hat, wenden die Vertragsparteien den Beschluss gemäß Artikel 27 Absatz 5 (V-V2) vorläufig an, es sei denn, die Schweiz teilt der Union mit, dass eine vorläufige Anwendung des Beschlusses nicht möglich ist, und begründet dies.»
Die Schweiz kann also intervenieren. Die im Vertrag beschriebene Ausnahme dazu erlaubt formal einen Aufschub. Gleichzeitig wird der Beschluss vorläufig angewendet. Theoretisch wäre es somit möglich, dass bestehendes CH-Recht noch gilt, aber gleichzeitig auch EU-Recht in Kraft ist. Unabhängig davon löst aber jeder Widerspruch bei Uneinigkeit faktisch das Eskalationsverfahren aus. Mit Schiedsgericht, EuGH-Auslegung der EU-Gesetzgebungsakte und möglichen Sanktionen. Aus Sicht des Autors ist seine Antwort formal korrekt. Doch genügt diese Sichtweise in einer bundesrätlichen Vorlage von solcher Tragweite? Kritiker meinen Nein.
Wie lesen Kritiker diese Antwort?
Die Kritiker erkennen einen Widerspruch. Denn mit der Annahme des Pakets werden die dynamisch eingebundenen EU-Gesetzgebungsakte völkerrechtlich verbindlich. Das bestätigt auch der eingangs zitierte Überblick des Bundesrates. Für das Stromabkommen heisst das: Die in Anhang I (A-I) aufgeführten EU-Gesetzgebungsakte gelten ab Vertragsabschluss direkt und dauerhaft auf Schweizer Hoheitsgebiet. Notabene: Der Vertrag führt im Anhang I 20 solche Rechtsakte auf. Sie haben ihrerseits einen Umfang von 796 Seiten (ohne Änderungen). Die bundesrätliche Übersicht spricht hingegen nur von 12 Gesetzgebungsakten. Wieso diese Umbenennung? Wieso diese unterschiedliche Anzahl? Das erschwert Lesbarkeit und Orientierung unnötig.
Auch spätere Änderungen dieser Rechtsakte werden automatisch übernommen, sofern kein Einwand der Schweiz erfolgt. Doch ein solcher Einwand ist nur unter hohem politischem und völkerrechtlichem Druck möglich. Denn die Schweiz hat kein Veto ohne Wenn und Aber, sie muss begründen und mit Folgen rechnen. Der sonst übliche Gesetzgebungsprozess kommt nicht zum Zug. Möglicherweise wollen Bundesrat und Befürworter das so. Die Kritiker möchten das nicht, denn es schränkt die freie Entscheidungsfreiheit der Schweiz ein.
Wie gehen wir mit diesen Unschärfen um?
Darf man sich auf den Standpunkt des Autors stellen? Sich rein formaljuristisch absichern? Die Kritiker meinen Nein, weil diese Abkommen völkerrechtlich verbindliche Verträge sind. Sie wurden auf der Basis eines gemeinsamen Verständnisses abgeschlossen. Und dieses gemeinsame Verständnis besagt: Der Normalfall soll auch normalerweise gelten.
Wenn Artikel 28 Absatz 3 (V-V3) sagt, dass der Beschluss «es sei denn» nicht anwendbar sei, signalisiert genau diese Formulierung den Ausnahmefall. Dieses «es sei denn» ist das Ventil. Wird es betätigt, beginnt das Eskalationsverfahren. Und dieses sieht vor, dass unter anderem der EuGH die Auslegung der fraglichen EU-Gesetzgebungsakte vornimmt. Als höchste richterliche Instanz der EU beurteilt er die Auslegung des EU-Rechts. Seine Auslegung ist für die Schweiz bindend.
Was ist also im Normalfall die Absicht der Vertragspartner?
Die EU und die Schweiz haben einen Vertrag geschaffen, der im Normalfall das EU-Recht in der Schweiz gültig werden lässt. Egal, ob mit der Integrationsmethode oder mit dem Äquivalenzansatz, das Ergebnis bleibt dasselbe: Schweizer Recht wird schrittweise durch EU-Recht ersetzt. Die Frage ist dann berechtigt, ob die Schweiz noch als souverän betrachtet werden kann, wenn bei der Integrationsmethode Teile ihres eigenen Rechts überflüssig werden und sich dieses schrittweise, erlauben Sie uns den Ausdruck, auflösen.
Es soll bei den Verhandlungen die Absicht der EU gewesen sein, möglichst alle Abkommen ausschliesslich mit der Integrationsmethode auszustatten. Die Schweiz werte es als Erfolg, dass sie die Äquivalenz teilweise beibehalten kann (D-4). Die Antwort darauf ist klar: Bei der Äquivalenz bleibt die eigene Gesetzgebung intakt.
Wir schliessen hier mit der Detailbetrachtung ab und schauen uns noch den Notausgang an.
Teil V des Stromabkommens mit seinen “Institutionelle Bestimmungen” umfasst alleine 15 Seiten. Das Protokoll über das Schiedsgerichtsverfahren ist auf 29 Seiten festgehalten (P-I). Das deutet darauf hin, dass dieses Verfahren minutiös vorbereitet ist. Beim Stromabkommen umfassen 27% des Vertragstextes die institutionelle Anbindung. Im Gesamtpaket sind es über 1/3 des Textes. So denkt die Schweiz gar nicht erst an Eskapaden. Das Verfahren ist so ausführlich, weil es möglichst nie zur Anwendung kommen soll. Es ist somit wirkungsvoll.
Doch ein Punkt sei angefügt: Wenn die Schweiz gegen das Abkommen verstösst, kann die EU sogenannte Ausgleichsmassnahmen ergreifen und sich wegen der Nichtübernahme funktional schadlos halten. Diese Massnahmen sind rechtlich nicht als Sanktionen bezeichnet, wirken aber faktisch so. Sie sind ein zentrales Druckmittel, um die Schweiz zur regelkonformen Übernahme von EU-Recht zu bewegen. Der Mechanismus greift auch umgekehrt. Allerdings ist die Schweiz in ihrer wirtschaftlichen Reichweite begrenzt und kann auf EU-Verletzungen praktisch kaum mit gleichwertigem Gegengewicht antworten.
Die Heirat zwischen der EU und der Schweiz ist folglich hochreguliert und lässt wenig Spielraum für Alleingänge.
Im Artikel 33 Absatz 1 steht dazu (V-V3): «Wenn die Vertragspartei, die gemäß Schiedsgericht gegen das Abkommen verstoßen hat, der anderen Vertragspartei nicht innerhalb einer angemessenen Frist gemäß Artikel IV.2 Absatz 6 des Protokolls mitteilt, welche Maßnahmen sie zur Umsetzung des Schiedsspruchs ergriffen hat, oder wenn die andere Vertragspartei der Auffassung ist, dass durch die mitgeteilten Maßnahmen dem Schiedsspruch nicht Folge geleistet wird, kann diese andere Vertragspartei im Rahmen des Abkommens oder eines anderen bilateralen Abkommens in den Bereichen betreffend den Binnenmarkt, an denen die Schweiz teilnimmt, verhältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen (im Folgenden „Ausgleichsmaßnahmen“) ergreifen, um ein mögliches Ungleichgewicht zu beheben. Sie notifiziert der Vertragspartei, die gemäß Schiedsgericht gegen das Abkommen verstoßen hat, die Ausgleichsmaßnahmen, die in der Notifikation anzugeben sind. Diese Ausgleichsmaßnahmen werden drei Monate nach ihrer Notifikation wirksam.»
Der Notausgang ist im Artikel 51 Absatz 2 zu finden (V-VII): «Die Union oder die Schweiz kann dieses Abkommen durch Notifikation gegenüber der anderen Vertragspartei kündigen. Das Abkommen tritt sechs Monate nach Erhalt dieser Notifikation außer Kraft.»
Die Schweiz könnte also das Stromabkommen kündigen. Doch die Folgen wären weitgehend von der EU abhängig, und zwar in jeder Hinsicht - wirtschaftlich, politisch, strukturell. Sie würden die Schweiz mit höchster Wahrscheinlichkeit substanziell treffen. Die Abkommen sind damit als dauerhafte Bindung konzipiert. So gesehen sind sie insbesondere bei der Handhabung mit der Integrationsmethode praktisch unkündbar. Es wäre eine Heirat ohne realistische Scheidungsmöglichkeit.
Kommt diese Eskalation nie zum Tragen, weil die Schweiz mitwirken darf?
Tatsächlich darf sich die Schweiz in Gremien einbringen, mitarbeiten, aber nicht mitentscheiden. So regelt Artikel 10 Absatz 2 (V-II) die Beteiligung der Schweiz an der Regulierungsbehörde ACER: «(a) die schweizerische Regulierungsbehörde an der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (im Folgenden „ACER“);».
Und im Anhang I Punkt (2) Anpassung (c) wird präzisiert: «(3) In Bezug auf die Schweiz hat ACER die ihr gemäß den Artikeln 3 bis 10 und 12 der Verordnung (EU) 2019/942 übertragenen Zuständigkeiten, sofern im Abkommen nichts anderes bestimmt ist. Bevor ACER eine die Schweiz betreffende Entscheidung trifft, hört sie die zuständige schweizerische Behörde an.»
Sowie weiter die Anpassung (e) «Die Regulierungsbehörde der Schweiz beteiligt sich vollwertig an der Arbeit des Regulierungsrates sowie aller anderen Vorbereitungsgremien von ACER, einschließlich Arbeitsgruppen, Ausschüssen und Taskforces, in Bezug auf Fragen, die unter dieses Abkommen fallen. Sie hat kein Stimmrecht im Regulierungsrat. Die Geschäftsordnung des Regulierungsrates und die interne Geschäftsordnung für die Funktionsweise der Arbeitsgruppen verleihen der Beteiligung der nationalen Regulierungsbehörde der Schweiz wirksam Ausdruck.»
Diese Mitwirkung soll nicht geschmälert werden. Im Gegenteil, sie ist durchaus nötig. Sie erfolgt jedoch ohne Stimmrecht und ohne Veto. Das Ergebnis bleibt dasselbe: Der eigentliche Gesetzgebungsprozess in der Schweiz bleibt aussen vor. Eine Vernehmlassung, wie wir sie jetzt gerade für dieses Paket durchführen, wäre in diesem Fall sinnlos. Die EU-Gesetzgebungsakte wäre bereits gestaltet. Es wäre ein Alibinachvollzug.
Damit ist das Mitwirkungsrecht zwar notwendig, aber kann bei der Integrationsmethode nicht die heute in der Schweiz gültigen Gesetzgebungsverfahren ersetzen. Es ist zu vermuten, dass das Mitwirkungsrecht im Prozess so wirken wird, dass die Beteiligung und damit die Involvierung der Schweiz zu einer faktischen Mitverantwortung führt, ohne dass die Schweiz tatsächlich mitentscheiden könnte. Eine spätere Eskalation würde so vermieden.
Was heisst das alles jetzt?
Es erklärt, warum die Kritiker gegenüber dem Paket Schweiz-EU Vorbehalte anmelden. Sie stellen nicht das Paket Schweiz-EU als Gesamtes undifferenziert in Frage. Vielmehr geht es um die eine Frage nach der institutionelle Anbindung, wie sie im Paket Schweiz-EU vorgeschlagen wird.
Wir haben dargestellt, wie aus unserer Sicht die bundesrätlichen Dokumente in entscheidenden Punkten als neutrale Entscheidungsgrundlage ungeeignet sind. In einer Vorlage dieser Tragweite wäre eine unmissverständliche und ausgewogenere Kommunikation nötig.
Eine abschliessende Expertise zur institutionellen Anbindung beispielsweise dreier unabhängiger Sachverständiger mit unterschiedlichen politischen Haltungen wäre hilfreich, damit die politische Ausgewogenheit garantiert wäre und sie als sorgfältige Entscheidungsgrundlage dienen könnte.
Es ist legitim, wenn aus persönlichen oder firmenpolitischen Überlegungen, vielleicht auch aus staatspolitischen Abwägungen, diese aus unserer Sicht fragwürdige Integrationsmethode akzeptiert würde. Dann aber in Kenntnis aller Konsequenzen. Diese Transparenz wäre das Mindeste, was die Schweiz als älteste direkte Demokratie der Welt von ihrem Souverän erwarten darf.
Sofern sich nicht überraschend andere Erkenntnisse ergeben, wären Nachverhandlungen in Betracht zu ziehen, die zumindest für die Integrationsmethode ein Veto ohne Wenn und Aber erwirken.
Damit ist das Time-out aufgehoben. Besten Dank für Ihr Engagement für die Schweiz.
Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz.
Das Paket Schweiz-EU würde unser Land grundlegend und unwiderruflich verändern. Es geht um die Frage wer künftig unser Recht bestimmt, Brüssel oder wir. Zum 1. August 2025 mein Appell: Mischen Sie sich ein. Unsere Heimat gehört den Menschen nicht der Politik. Ein Blick auf die FDP zeigt warum.
(c) 2017: Capanna Monte Bar, Capriasca, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Das Stromabkommen im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit.
Das neue Stromabkommen (Elektrizität) im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit ist ein zentrales Element des Pakets Schweiz–EU. Es offenbart im Perspektivenwechsel ein unerwartetes Ausmass an gegenläufigen Erwartungen der Vertragspartner. Wer eintauchen will, dieser Artikel ist die richtige Gelegenheit dazu.
(c) 2019: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Orginalwortlaut Stromabkommen - hier online verfügbar.
Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? Wir haben die 163 Seiten des Stromabkommens ordentlich strukturiert und im Originalwortlaut der EU auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Wir leisten damit einen Beitrag zur Lesbarkeit dieses Abkommens. Wir hoffen, dass viele so einen einfacheren Zugang dazu finden und unser Angebot nützlich ist.
Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint.
Ein umfassendes Paket von Abkommen zur Festigung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt jetzt auf dem Tisch. Es bildet die Grundlage für eine folgenschwere Entscheidung der Schweiz, die es ernsthaft auszuloten gilt.
(c) 2025, Schloss Wildegg, Möriken-Wildegg, Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser.
Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.
Hier finden Sie die Stellungnahme von smartmyway zum Paket Schweiz-EU im Rahmen der offiziellen Vernehmlassung.
(c) 2016: Gewittersturm, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
smartmyway unterwegs.
(c) 2013: Monte Generoso, Capolage, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.
Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management