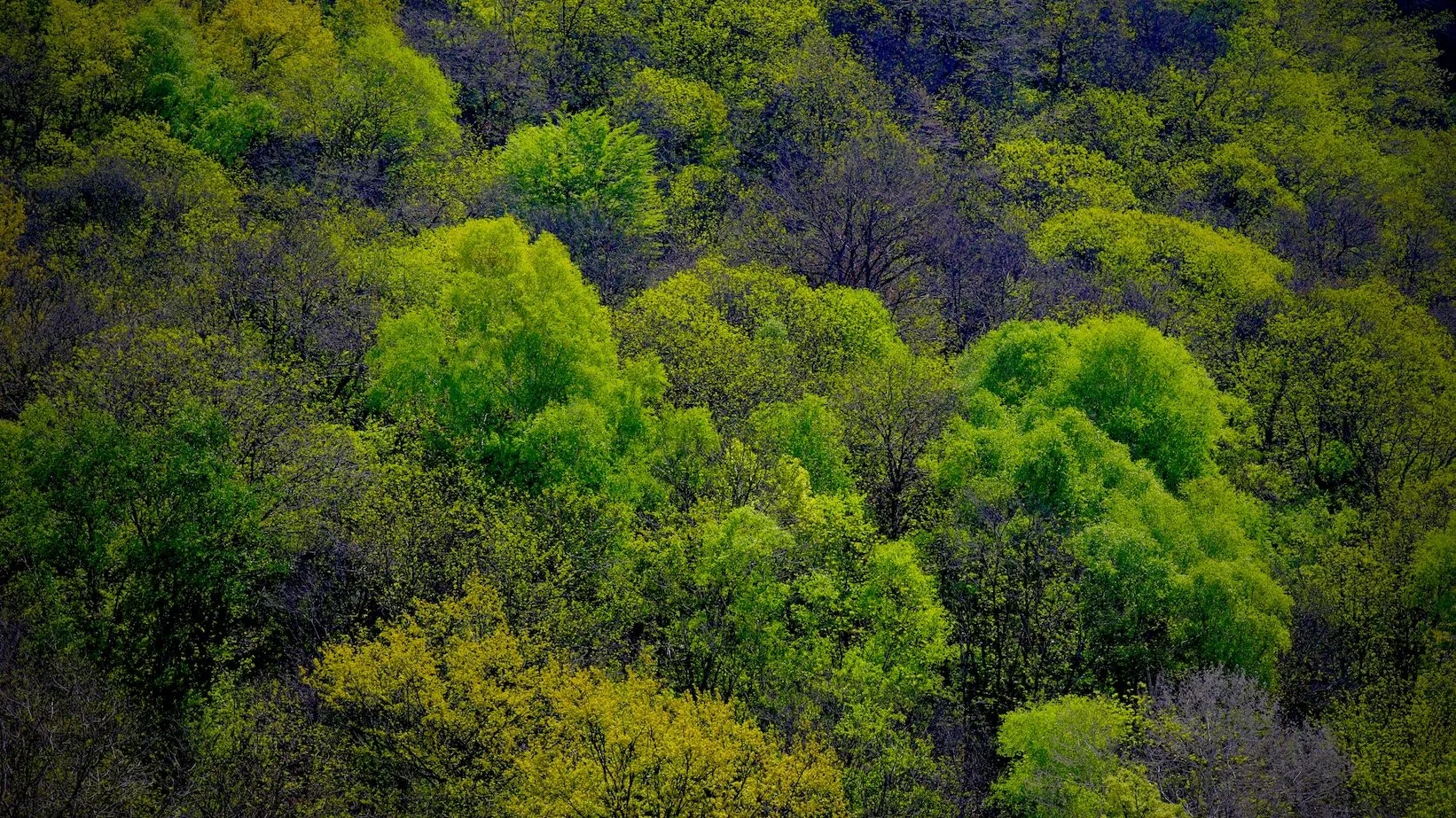Dieses Paket braucht Klartext. Für die Schweiz.

Unser Nein zur Vernehmlassung zum Paket Schweiz-EU. Von Bürgern für den Bundesrat. Mit neun Seiten Klartext nach etwas über drei Monaten intensiver Arbeit. Unser Schluss aus Bürgersicht: Wir lehnen die neue Grundidee der «Integration statt Kooperation» klar ab.
Es steht ausser Frage, dass stabile Beziehungen mit der EU und die Weiterentwicklung des bilateralen Weges für die Schweiz von grosser Bedeutung sind. Der Bundesrat empfiehlt dazu das Paket Schweiz-EU als nächsten Schritt.
Natürlich enthält dieses Paket sowohl positive als auch negative Aspekte. Über diese kann man diskutieren, sich uneinig sein, einen Konsens anstreben und am Ende gemeinsam einen Mehrheitsentscheid mittragen.
Doch das vorliegende Paket Schweiz-EU geht weiter. Es ist keine gewöhnliche Fortsetzung der Bilateralen I und II. Es verändert mit der neuen sektoriellen Integration der Schweiz in den EU-Binnenmarkt die Beziehung mit der EU grundsätzlich und daraus folgend das Selbstverständnis der Schweiz.
Die Geheimniskrämerei anfangs Jahr war fragwürdig. Doch die unausgewogene Kommunikation des Bundesrates und seiner Fachstellen in den Vernehmlassungsunterlagen sowie die Komplexität und der Umfang der Vorlage haben uns ernsthaft irritiert. Daher lag unser Augenmerk vermehrt auf den Risiken und weniger auf den zweifellos vorhandenen Chancen des Pakets.
Das Paket hat grosse Relevanz für die Jugend und damit für die Zukunft des Landes. Diese Tragweite veranlasst uns, das Paket nach sorgfältiger Abwägung der Risiken in der aktuellen Form abzulehnen. Alles andere wäre unklug und hätte kurzfristigen Charakter. Es würde primär den heute etablierten Kreisen und eher wenigen Profiteuren nützen. Diese Einschätzung ergänzen wir mit unserer Beobachtung, dass dieses Vertragswerk zu viel Interpretationsspielraum offen lässt, wie die kontroversen Diskussionen zeigen.
Es ist so nicht praxistauglich und wird aufgrund des Ungleichgewichts zwischen der EU und der Schweiz mit Nachdruck und zum Nachteil des kleinen Landes ausgelegt werden. Wir sagen daher doppelt Nein. Nein zum Paket Schweiz-EU in der vorliegenden Version und Nein zu dieser Art und Weise der Vernehmlassung und zum Vorgehen des Bundesrates.
Im Folgenden überlassen wir Ihnen den Wortlaut unserer Vernehmlassungsantwort, die wir dem Bundesrat eingereicht haben. Mit diesem 15. Artikel schliessen wir unsere Artikelserie zum Paket Schweiz-EU während der Vernehmlassungsphase ab. Lassen Sie uns gerne Ihr konstruktives Feedback zukommen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihre Lesertreue.
Roland Voser & Maurizio Vogrig, 30. September 2025
EINSCHREIBEN
An den Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Bundeshaus
3003 Bern
30. September 2025
Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin,
Sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates,
vielen Dank für die Möglichkeit der Vernehmlassung zum Paket Schweiz-EU. Wir erlauben uns, Ihnen im Folgenden unsere Stellungnahme zukommen zu lassen. Wir tun dies aus Bürgersicht, weil diese Interessen während der Vernehmlassung ungenügend einfliessen. Dazu äussern wir als Bürger dieses Landes frei unsere Meinung, tun dies aus eigener Motivation, unabhängig und auf eigene Kosten. Wir stellen Ihnen unsere Erkenntnisse unentgeltlich zur Verfügung, obwohl sie erheblichen Aufwand verursacht haben. Wir hoffen, damit einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Unsere Analyse basiert auf den EU-Abkommen im Originalwortlaut sowie den Vernehmlassungsunterlagen des Bundesrates, jeweils vom 13. Juni 2025. Auf dieser Grundlage spiegeln wir Ihnen unsere Schlussfolgerungen.
Wir sind zur Überzeugung gelangt, dass die vom Bundesrat bzw. den involvierten Bundesstellen geleistete Arbeit zur Vorlage Paket Schweiz-EU unzureichend ist. Wir begründen dies wie folgt:
Der Bundesrat stellt nicht einfach eine Stabilisierung und Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen zur Diskussion, sondern vielmehr eine sektorielle Integration der Schweiz in den EU-Binnenmarkt. Diese betrifft die fünf Sektoren Freizügigkeit, Luftverkehr, Lebensmittelsicherheit, Elektrizität und Gesundheit. Diese Klärung ist grundlegend für eine sachgerechte Einordnung des Pakets.
Damit haben diese Abkommen aus unserer Sicht den Charakter von Integrationsverträgen. Es sind völkerrechtliche verbindliche Assoziierungsabkommen, die das Nichtmitglied Schweiz an die supranationale Gemeinschaft der EU binden, ohne dass die Schweiz Vollmitglied wird.
Das Konzept der direkten Gültigkeit von EU-Verordnungen und EU-Richtlinien in der Schweiz stellt eine zentrale Veränderung gegenüber der bisherigen Praxis dar. Erste Ausnahmen sind zwar bereits in den Sektoren Freizügigkeit und Luftverkehr zu finden sowie in der Schengen-Dublin-Assoziierung. Doch bisher beruhte das Verhältnis mehrheitlich auf der Äquivalenz zwischen EU-Recht und Schweizer Recht, also auf gegenseitiger Anerkennung und rechtlicher Gleichwertigkeit. Es war Ausdruck einer partnerschaftlichen Kooperation. Mit dem Paket wird nun in den betroffenen Sektoren diese Kooperation durch eine vertiefte Form der Integration ersetzt.
Damit werden nach unserem Verständnis künftig EU-Verordnungen in der Schweiz unmittelbar gelten, ohne zuvor in ein Schweizer Gesetz aufgenommen zu werden und ohne dass die Schweiz ihre Entstehung final mitbestimmen kann oder konnte. In den erfassten Bereichen treten sie an die Stelle bestehender nationaler Regelungen oder erweitern diese verbindlich durch supranationale Vorgaben. Die Gesetzgebungsarbeit verlagert sich faktisch und verstärkt in die EU. Zugleich kann der Druck möglicher EU-Sanktionen innerhalb der verbleibenden oder nachvollziehenden Schweizer Gesetzgebung letztlich die freie Willensäusserung in den Volksrechten beeinträchtigen.
Hinzu kommen EU-Richtlinien, die in Schweizer Gesetze in der Weise übersetzt werden müssen, dass ihre Wirkung exakt der Richtlinie entspricht. Es ist eine zwingende technische Integration ohne relevanten Gestaltungsraum seitens der Schweiz.
EU-Verordnungen und EU-Richtlinien sind die sogenannten EU-Rechtsakte, die auch für EU- sowie EWR-Mitglieder gelten. Damit wird die Einheitlichkeit im EU-Rechtsraum sichergestellt. Die EU als Organisation ist also die Regelgeberin für den EU-Raum bzw. den EU-Binnenmarkt. Die EU ist aber selbst kein Handelspartner. Für die Schweiz sind die wirtschaftlichen Beziehungen mit den einzelnen Mitgliedstaaten relevant.
Will die Schweiz am EU-Binnenmarkt partizipieren, muss sie dennoch und logischerweise auch dessen Regeln übernehmen. Das ist der eigentliche Kern des Pakets. Denn mit dieser verstärkten sektoriellen Integration schränkt es die Souveränität der Schweiz stärker ein, als es bisher bei den Bilateralen I und II der Fall war. Die Schweiz wird nicht als Drittland mit den Ländern des EU-Binnenmarktes handeln, sondern sie und ihr Hoheitsgebiet werden in den jeweiligen Sektoren selbst Teil des Binnenmarktes. Dieser Unterschied ist matchentscheidend. Die EU gibt dort den Takt an, dem die assoziierte Schweiz künftig zu folgen hat. In entscheidenden Sektoren wird die Rolle der Schweiz somit erschwert reaktiv werden, ähnlich wie es in einer Passivmitgliedschaft der Fall ist.
Im Streitfall über EU-Verordnungen entscheidet für die Schweiz nicht länger abschliessend das Bundesgericht, sondern der EuGH. Zugleich sollen geänderte EU-Verordnungen trotz noch laufender Verfahren vorläufig angewendet werden. Damit stellt sich unseres Erachtens die Frage, ob während der Übergangsphase das bisherige oder das neue Recht massgeblich ist; das schafft Rechtsunsicherheit. Ferner kann die EU gegen die Schweiz Ausgleichsmassnahmen vorsehen und verhängen, wenn die Schweiz diesen Verordnungen nicht Folge leistet. Dies geschieht mit Einverständnis der Schweiz, weil sie die entsprechenden institutionellen Protokolle unterzeichnet hat. Die im erläuternden Bericht verwendeten Schwellenwörter wie «relevant» und «notwendig» sind in der Praxis keine Schranke, denn sobald EU- oder inhaltsgleiches Recht berührt ist, liegt die Auslegung beim EuGH.
Der Paket-Ansatz führt in unserem Verständnis dazu, dass Retorsionsmassnahmen jeden Sektor betreffen können, nicht nur den Ursprungssektor. Wenn die Schweiz beispielsweise im Stromabkommen einem EU-Rechtsakt nicht Folge leisten will, kann die EU ihre Sanktionen im MRA-Abkommen umsetzen, unabhängig vom Ursprungssektor. Ein unseres Erachtens selbst regelwidriges Verhalten hat sie bereits so gezeigt, etwa beim Ausschluss aus Horizon oder dem Entzug der Börsenäquivalenz.
Die Asymmetrie der Grösse der EU im Vergleich zur Schweiz setzt letztere in jedem Fall überdurchschnittlich unter Druck. In diesem Punkt unterscheidet sich die künftige Situation auch von den EWR-Ländern, denn diese haben für den Streitfall mit dem EFTA-Gerichtshof eine eigene und vom EuGH unabhängige Rechtsprechung. Eine solche unabhängige Säule fehlt im Paket Schweiz-EU vollständig.
Über die Bedeutung dieser Einschränkung der Souveränität aufgrund des Pakets kann diskutiert werden. Als einfache Methode zur Abschätzung des Umfangs zählen wir Seiten. Wir tun dies in der Annahme, dass EU-Gesetze grundsätzlich sinnvoll sind, also inhaltlich nicht fragwürdig oder unnötig. Wir haben 96 EU-Verordnungen gezählt und im EU-Portal CELEX dazu 3'778 Seiten für die jeweiligen Gesetze erhoben, die im Paket Schweiz-EU referenziert werden (Stand August 2025). Dabei haben wir ihre Änderungen nicht mitgezählt. Wir haben 38 EU-Richtlinien gezählt, die einen Umfang von 610 Seiten aufweisen. Wir haben im Freizügigkeitsabkommen weitere 34 EU-Rechtsakte im Umfang von 130 Seiten gefunden, die Schweizer Gerichte künftig in ihrer Rechtsprechung berücksichtigen müssten. Im gleichen Abkommen finden sich weitere 7 EU-Rechtsakte im Umfang von 21 Seiten, die unverbindlich zur Kenntnis genommen werden. Das ist zweifellos eine grosse Menge importiertes Recht. Im Streitfall entscheidet die EU über die Auslegung.
Weitere EU-Rechtsakte, die gemäss den Abkommen in der Schweizer Gesetzgebung beachtet werden müssen, finden sich beispielsweise im Stromabkommen in den Anhängen III und IV (staatliche Beihilfen), Anhang V (Umwelt) oder Anhang VI (Erneuerbare Energien). Dies bedeutet faktisch die Angleichung der Schweizer Gesetze ans Umweltrecht der EU. Dasselbe gilt bei staatlichen Beihilfen und erneuerbaren Energien. Sie stellen also den zukünftigen Minimalstandard auch für die Schweiz dar. Zudem setzt der Anhang II (Übergangsregelungen für bestehende langfristige Einspeisevorränge bzw. exklusive Rechte zur Nutzung von Grenzkapazitäten auf bestimmten Stromleitungen zwischen Schweiz und Frankreich) die bisherige Sicherstellung der Energielieferungen von und nach Frankreich während der Winterlücken nach Ablauf der Übergangsfristen ausser Kraft. Dies wird die Versorgungssicherheit der Schweiz möglicherweise schwächen. Die Auswirkungen auf die Schweiz all dieser Bestimmungen sind weitreichend und werden ihre Souveränität empfindlich einschränken. Um dies zu erkennen, müssen wir keine Rechtsexperten sein. Dies sind Beispiele aus dem Stromabkommen. Auf weitere Aufzählungen verzichten wir, doch die kumulative Wirkung all dieser Bestimmungen in allen vorliegenden Abkommen kann unserer Ansicht nach heute niemand verlässlich abschätzen. In dieser Konstellation erkennen wir ein erhebliches staatspolitisches Risiko für die Schweiz.
Wir stellen zusätzlich fest, dass beispielsweise das Freizügigkeitsabkommen nicht in seiner ganzen Form vorliegt, sondern bloss als Änderungsprotokoll. Es ist praktisch unmöglich, die Freizügigkeit in ihrem wahren Umfang im vollständigen Wortlaut vor sich zu haben. Die gleiche Situation herrscht beim Landverkehr, der Konformitätsanerkennung und der Landwirtschaft. Damit stehen die notwendigen Entscheidungsgrundlagen in wichtigen Sektoren nicht in geeigneter Weise zur Verfügung. Dies verunmöglicht eine freie Willensbildung.
Zum Vergleich haben wir auch die 55 wichtigsten Bundeserlasse im Schweizer Portal Fedlex gesucht und ihre Seitenzahl gerechnet: Die 55 wichtigsten Bundeserlasse (BV, OR, StGB, StPO, ZGB, ZPO, ArG, AIG, BVG, BGG, DSG, DBG, KVG, MWSTG, OBG, SchKG, ATSG, SVG, UVG, VTS, VRV, ParlG, RVOG, FHG, KG, EnG, EleG, KEG, USG, RPG, AHVG, IVG, AVIG, BetmG, WG, AsylG, LwG, LMG, VGG, LFG, PüG, AVG, FZG, ETHG, HFKG, EBG, BöB, MedBG, StromVG, TSchG, TSG, REMIT-Gesetz, BHÜG, KBG sowie Bundesgesetz Friedensförderung/Menschenrechte) umfassen 4'144 Seiten (Stand August 2025). Die Übernahme von 96 EU-Verordnungen und 38 EU-Richtlinien sowie der zusätzlichen Bestimmungen führt zu einer erheblichen Ausweitung des in der Schweiz geltenden Rechtsbestands. In der Summe ergibt das gut das Doppelte der Seitenzahl im Vergleich zu den 55 wichtigsten Bundeserlassen. Dies geht weit über das normale Mass hinaus, das bisher in Vorlagen präsentiert wurde. Die Grundlagen sind ausgewiesen und nachprüfbar: https://www.smartmyway.ch/paketeuch-lh (beinhaltet Links zu den Primärquellen).
Dieses neue EU-Recht betrifft künftig mit den erwähnten 5 Sektoren vitale Lebensbereiche der Schweiz und ihrer Menschen und Firmen, die entscheidend für die Schweizer Standort- und Wettbewerbsvorteile sind. Diese Vorteile sind für die nachhaltige Erfolgsposition der Schweiz von fundamentaler Bedeutung und unserer Ansicht nach jetzt in besorgniserregender Weise gefährdet.
Es bedeutet, dass dieses Recht für alle Menschen und Firmen in der Schweiz gilt, egal ob sie nur in der Schweiz tätig sind oder auch in der EU. Die Übernahme technischer EU-Verordnungen führt in der Praxis zu einem einheitlichen Standard für den Schweizer Markt. Das gilt auch für Produkte, die ausschliesslich in der Schweiz verbleiben. Zwei unterschiedliche Rechtsordnungen können nicht gleichzeitig auf denselben Sachverhalt angewendet werden. Die andernfalls nötigen Ausnahmebestimmungen sind uns nicht bekannt. Wie sollen kleine und mittlere Unternehmen hier den Durchblick behalten? Müssen diese Unternehmen nun mit rechtlichen Unsicherheiten oder Verfahren rechnen, wenn sie EU-Vorgaben nicht befolgen? Zwar sind Schweizer Behörden zuständig, doch diese müssen sich an EU-Recht orientieren. Und bei Differenzen mit der EU greift das gesamte Streitbeilegungssystem des Pakets bis hin zu Ausgleichsmassnahmen.
Freihandelsabkommen mit Drittstaaten koppeln sich faktisch an EU-Standards, sobald die Schweiz diese im Binnenmarktbereich übernimmt. Das kann zu Wettbewerbsnachteilen führen. Im US-Zollfall haben wir aus Rücksicht auf EU-Kompatibilität eine strategische Zurückhaltung der Schweiz beobachtet. Damit wurden aus unserer Sicht konkrete Vorteile verspielt. Ohne solche EU-Vorgaben entscheidet ein Unternehmen selbständig, ob es sich an Binnenmarktregeln anlehnt oder nicht. Eine Erleichterung für einzelne darf in diesem Fall nicht zulasten vieler anderer gehen. Wäre im Paket auch ein Abkommen für Pharma oder Medtech enthalten, das neu EU-Verordnungen und EU-Richtlinien ebenfalls direkt in der Schweiz verbindlich macht, wäre der Widerstand aus diesen Branchen sehr wahrscheinlich. Denn im einheitlichen Binnenmarkt gingen die heute bestehenden Standortvorteile der Schweiz zumindest langfristig verloren.
Hinzu kommen die Bestimmungen der 13 Abkommen im Umfang von 1'117 Seiten (EU-Originale), die ebenfalls in die Schweizer Gesetze wie bisher bei den Bilateralen I und II überführt werden müssen. Dies gilt insbesondere auch für die weiteren Abkommen Landverkehr, Konformitätsanerkennung, Landwirtschaft. Dasselbe gilt für die nichtsektoriellen Abkommen (finanzieller Beitrag, Programme, Weltraum und flankierende Begleitmassnahmen). Dazu sind gemäss Vernehmlassungsunterlagen insgesamt 9 Bundesbeschlüsse im Umfang von 164 Seiten nötig.
Damit übernimmt die Schweiz im Total in erheblichem Masse supranationales Recht und gibt damit einen wesentlichen Teil ihrer Souveränität an die EU ab. Dies widerspricht den Entscheiden des Volkes gegen den EWR im Jahre 1992 und ebenso dem Abbruch des InstA durch den Bundesrat im Jahre 2021. Ausschlaggebend für beide Entscheidungen war die Ablehnung einer solchen Rechtsübernahme.
Dieses Paket verschiebt Gesetzgebungskompetenz im hohen Masse in die EU und ordnet damit EU-Recht vor Schweizer Recht ein, was unseres Erachtens eine Änderung von Art. 190 BV nach sich zieht. Unabhängig davon unterläuft dies die Erfolgsfaktoren der Schweiz, die sich nur agil und situativ in dieser Welt behaupten und ihren hohen Wohlstand halten kann. Direkte Demokratie, Neutralität und Föderalismus sind die tragenden Säulen des Erfolgsmodells Schweiz. Genau diese werden durch das Paket Schweiz-EU langfristig in Frage gestellt.
Die Konsequenzen sind nicht absehbar. Benötigt es beispielsweise weitere Entlastungspakete, die Einsparungen in der Schweiz vornehmen, damit der erhebliche jährliche finanzielle Beitrag an die EU geleistet werden kann, und mit welchen Folgen? Hilft das Paket Schweiz-EU die Wohnungsnot zu lindern, die überlastete Infrastruktur zu entlasten, die Krankenkassenprämien zu reduzieren? Was bedeutet der absehbare Wegfall der Boomer-Fachkräfte oder die Substitution von Arbeitsplätzen durch KI? Unserer Ansicht nach adressiert das Paket Schweiz-EU die grossen Herausforderungen der Schweiz und ihrer Menschen nicht oder ungenügend.
Das Paket löst diese Probleme nicht, weil es nicht zukunftsgerichtet ist. Bereits die Bilateralen I und II haben den Bedürfnissen der Bevölkerung offensichtlich zuwenig entsprochen. Zwar wuchs das kaufkraftbereinigte BIP pro Kopf, doch das verfügbare Haushaltseinkommen pro Kopf stagnierte (Quellen Weltbank und BfS). Der Erfolg der Bilateralen kommt also nicht wie gewünscht bei den Menschen an. Das Paket Schweiz-EU gibt ihnen dazu erneut keine neue starke Perspektive.
Das Paket könne nicht nachverhandelt werden, wird von Befürwortern behauptet. Damit ist einer korrekten Vernehmlassung im Umkehrschluss die Grundlage entzogen. Eine konstruktive Rückmeldung wird dadurch obsolet und die Antwort auf ein einfaches Ja oder Nein reduziert. Aus unserer Sicht wird so eine zielführende parlamentarische Diskussion in wesentlichen Belangen verunmöglicht und der Abstimmungskampf faktisch in die Vorphase verlagert. Das ist für die demokratische Willensbildung äusserst problematisch.
Nicht zuletzt schiesst das Paket über das Ziel hinaus. Es bleibt unklar, welches konkrete Problem der Bundesrat mit diesem Paket eigentlich lösen will. Es ist überdimensioniert und seine Regulierungen unpassend für die Menschen und insbesondere die kleinen und mittleren Firmen, die das Rückgrat der Schweiz darstellen. Regulierung ruft nach mehr Regulierung, weil sie niemand mehr versteht und immer mehr Begleitmassnahmen nötig werden. Das wäre eine verheerende Entwicklung. Denn dabei geht die Bürgernähe systematisch und unumkehrbar verloren.
Das Paket Schweiz-EU ist für uns Ausdruck einer zu einseitigen Aussenpolitik. Sie vermittelt den Eindruck von Unsicherheit und fehlender Gestaltungskraft. Stabilität und Sicherheit können für ein kleines Land nicht durch Integration und Regulierung in supranationalen Organisationen erreicht werden. Vielmehr entstehen sie durch möglichst unbehinderte Innovation und unabhängige Schaffenskraft. Entscheidend ist dabei der Zugang zu weltweiten Spitzenmärkten, von den USA, China und Indien bis zu den unmittelbaren Nachbarn Baden-Württemberg und der Lombardei. Es sind diese wirtschaftlichen Beziehungen zu unseren wichtigsten Handelspartnern, die den Erfolg der Schweiz tragen. Diese massgeschneiderte Vielfalt und Unabhängigkeit gehören zum kulturellen Kern der Schweiz. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass das Land seine hervorragende wirtschaftliche und gesellschaftliche Position im internationalen Vergleich aus eigener Kraft behaupten konnte. Gerade in einer unsicheren Zukunft ist diese Haltung nicht nur erfolgversprechend, sondern stösst auch in der Bevölkerung auf breiten Rückhalt.
Unser Nein zu diesem Paket ist kein Nein zur Zusammenarbeit mit der EU. Es ist ein Nein zur institutionellen Anbindung ohne Mitbestimmung und ohne erfolgsversprechende Perspektive für kommende Generationen. Für Kooperation braucht es Souveränität und nicht deren Aufgabe.
Dies gilt für ein kleines und erfolgreiches Land umso mehr. Aus diesem Grund lehnen wir die im Paket enthaltene Grundidee «Integration statt Kooperation» ab. Die effektiv rote Linie sind für uns EU-Verordnungen und EU-Richtlinien, die in der Schweiz gelten, aber nicht von der Schweiz gestaltet, verändert oder entschieden werden. Dieser Umstand ist im Paket Schweiz-EU zu streichen. Ohne Wenn und Aber.
Die Gesamtheit der aufgezeigten Sachverhalte und das bundesrätliche Vorgehen verletzen unserer Ansicht nach
Art. 2 BV Abs. 1 («Die Schweizerische Eidgenossenschaft [...] wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes»),
Art. 121a BV Abs. 2 («Es dürfen keine völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden, die gegen diesen Artikel verstossen») und
Art. 140 BV Abs. 1 lit. b («Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet: der Beitritt [...] zu supranationalen Gemeinschaften»).
Wir wollen Ihre Arbeit nicht schmälern. Doch hätten wir vom Bundesrat und den Fachstellen im Sinne einer ausgewogenen Information mindestens den hier vorliegenden Gehalt in geeigneter Form als erste minimale Lesehilfe erwartet. Ohne eine solche Unterstützung und Orientierung ist eine fundierte Entscheidungsfindung während der Vernehmlassung für Interessengruppen und Parlamentarier sowie später für den Souverän unrealistisch. Damit verhindert der Bundesrat letztlich eine offene und transparente Diskussion und Entscheidungsfindung.
Als kleiner Verlag wissen wir, dass es nahezu unmöglich ist, die Vernehmlassungsunterlagen in der vom Bundesrat zur Verfügung gestellten Vernehmlassungszeit zu lesen, geschweige denn zu verstehen oder die weitreichenden Konsequenzen recherchieren und abschätzen zu können.
Die widersprüchlichen Aussagen von Bundesräten, Fachleuten und Politikern sowie die in Medien herrschende Verwirrung und die oft unsachliche Diskussion in den sozialen Medien sind das Ergebnis daraus.
Der Bundesrat läuft damit Gefahr, das Land zu spalten und verletzt unseres Erachtens
Art. 34 BV Abs. 2 («Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung»).
Weiter setzt das Paket auf einem entscheidenden Punkt der Bundesverfassung auf. Die Grundlage dafür, dass EU-Verordnungen in der Schweiz überhaupt unmittelbar zur Anwendung kommen können, bilden nicht die Abkommen selbst, sondern
Art. 190 BV («Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend»).
Dieser stellt Bundesgesetze und Völkerrecht und somit die völkerrechtlich verbindlichen Abkommen mit der Folge gleich, dass EU-Recht in den betroffenen Sektoren direkt wirkt, auch ohne EU-Mitgliedschaft. Ohne diese verfassungsrechtliche Öffnung würde das Paket keine unmittelbare Rechtswirkung entfalten. Weil jedoch EU-Verordnungen Vorrang vor Schweizer Recht erhalten sollen, ist eine Verfassungsänderung notwendig.
Wir legen die Bundesverfassung als Bürger aus und machen damit unser verfassungsrechtliches Verständnis transparent. Wir kommen zum Schluss, dass diese Vernehmlassung den Vorgaben von Art. 2, Art. 34, Art. 121a, Art. 140 und Art. 190 BV nicht genügt. Falls eine grundsätzliche Änderung wie im Paket enthalten tatsächlich gewollt ist, ist sie als Verfassungsänderung offen vorzulegen. Für eine unverfälschte Willensbildung gemäss Art. 34 BV und die Prüfung des Ständemehrs nach Art. 140 BV erwarten wir eine offene und vollständige Kommunikation über die tatsächliche Architektur der Streitbeilegung. Zusätzlich erwarten wir eine unmissverständliche Darstellung der Wirkung von Art. 190 BV, der Völkerrecht dem nationalen Recht gleichstellt, und welche Konsequenzen sich daraus für das Paket Schweiz-EU ergeben.
Nur so wird erkennbar, welche Machtverschiebung das Paket konkret bedeutet. Es wird transparent, wer künftig über zentrale Bereiche entscheidet, nach welchem Recht das geschieht und welche Auswirkungen dies auf die Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung der Schweiz als souveränen Staat sowie für die Kantone, die Unternehmen und letztlich die Menschen hat.
Erlauben Sie uns abschliessend eine übergeordnete Bemerkung. Die politische und wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der EU und insbesondere in den beiden für die Schweiz zentralen Nachbarländern Deutschland und Frankreich erfüllt uns mit grosser Sorge. In vielen Bereichen wie Migration, Fiskalpolitik und Rechtsstaatlichkeit beobachten wir eine zunehmende Erosion grundlegender Prinzipien. In unserer Wahrnehmung entfernt sich diese Entwicklung von der offenen und bürgernahen Rechts- und Gesellschaftskultur der Schweiz.
Zahlreiche Mitgliedstaaten wenden EU-Recht nicht mehr verlässlich an, während zentrale Herausforderungen wie Zuwanderung und Energiesicherheit sowie der strukturelle Rückstand neuer Technologien ungelöst bleiben. Gleichzeitig geraten öffentliche Haushalte, Sozialwerke und kommunale Strukturen unter Druck. Deutschland sieht sich mit einer zunehmenden Verschuldung und regionaler Zahlungsunfähigkeit konfrontiert, Frankreich ist strukturell instabil. Auch Italien kämpft mit hoher Staatsverschuldung und strukturellem Reformstau, während Österreich wirtschaftlich eng an Deutschland gebunden ist und innenpolitisch unter wachsendem Druck steht.
In geopolitischer Hinsicht entfernt sich ein stabiler Frieden in Europa, nicht zuletzt im Ukraine-Konflikt, zusehends. Zugleich steigt die Bedrohungslage auf Nato-Gebiet, ohne dass die europäischen Staaten darauf ausreichend vorbereitet wären. Dies gilt im Übrigen auch für die Schweiz. Die USA sehen sich mit der grössten je gesehenen Schuldenlast konfrontiert. Die BRICS-Staaten verfolgen einen neuen Goldstandard, der das globale Finanzsystem in Frage stellt.
Vor diesem Hintergrund halten wir es für falsch, die institutionelle Anbindung der Schweiz an die EU in einer Weise zu vertiefen, die unsere eigenständige Handlungsfähigkeit massgeblich schwächt. Die Schweiz sollte in dieser Lage nicht den Weg der Integration suchen, sondern sich auf ihre hervorragende Position besinnen und ihre eigene Resilienz sofort und konsequent stärken, ihre Eigenständigkeit bewahren und Lösungen für die drängenden Herausforderungen wie Zuwanderung, Energie und sozialen Zusammenhalt jetzt umsetzen.
Wir bitten Sie, das weitere Vorgehen so anzupassen, dass die Interessen einer eigenständigen und erfolgreichen Schweiz wieder ins Zentrum rücken.
Eine Kopie dieses Schreibens schicken wir an vernehmlassung.paket-ch-eu@eda.admin.ch.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
smartmyway ag
Roland Voser & Maurizio Vogrig
Teilhaber, Bürger von Neuenhof/AG bzw. Busswil/TG
Anhang mit Vertiefungen
Deutschland – kommunale Zahlungsunfähigkeit und Staatsverschuldung: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt in seiner Analyse „Bilanz 2024 + Ausblick 2025“ vor einer zunehmenden Überforderung der kommunalen Haushalte. Gleichzeitig steigt die gesamtstaatliche Verschuldung weiter an. Link: https://www.dstgb.de/publikationen/dokumentationen/bilanz-2024-und-ausblick-2025/
Frankreich – strukturelle Instabilität: Die OECD diagnostiziert in ihrer „Economic Survey France 2024“ tiefgreifende strukturelle Probleme, ein anhaltend hohes Haushaltsdefizit und politische Instabilität im Zuge gesellschaftlicher Spannungen. Link: https://www.oecd.org/economy/france-economic-snapshot
Italien – Schuldenlast und Reformstau: Das „In-Depth Review 2024 – Italy“ der EU-Kommission stellt hohe Verschuldung und strukturellen Reformstau fest. Link: https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/depth-review-2024-italy_en
Österreich – wirtschaftliche Abhängigkeit und innenpolitischer Druck: WIFO beschreibt 2024/25 den Exportrückgang u. a. mit der schwachen Entwicklung in Deutschland, dem wichtigsten Exportmarkt Österreichs. Link: https://www.wifo.ac.at/en/news/2024-was-a-challenging-year-for-austrian-foreign-trade/
USA – historische Schuldenlast: Gemäss den offiziellen Zahlen des U.S. Treasury beläuft sich die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten im Jahr 2025 auf über 34 Billionen Dollar – der höchste jemals verzeichnete Wert. Link: https://fiscaldata.treasury.gov/datasets/debt-to-the-penny/debt-to-the-penny
BRICS – Goldstandard-Initiative: In der „Johannesburg II Declaration“ des BRICS-Gipfels 2023 wird offiziell über eine alternative Handelswährung mit Rohstoffdeckung diskutiert. Link: https://www.gov.za/sites/default/files/speech_docs/Jhb%20II%20Declaration%2024%20August%202023.pdf
Nato – mangelnde Verteidigungsbereitschaft Europas: Im „Secretary General’s Annual Report 2024“ werden Investitions- und Fähigkeitslücken erläutert; der Report ist auf der Nato-Themenseite verlinkt und als PDF abrufbar. Link (PDF): https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2025/4/pdf/sgar24-en.pdf Übersichtsseite: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_212668.htm. NATO+1
EU – Rückstand bei Schlüsseltechnologien: Der „State of the Digital Decade 2024“ der EU-Kommission dokumentiert den technologischen Rückstand Europas in KI, Halbleitern, Cloud und Cybersicherheit. Link: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/state-digital-decade-2024-report
Mehr EU bringt nicht mehr. Ausser mehr Unvernunft.
Das Paket Schweiz-EU ermöglicht künftig, dass EU-Recht für relevante Lebensbereiche direkt in der Schweiz gilt. Die EU steuert sektoriell die Handelsbeziehungen der Schweiz mit den EU-Mitgliedsländern. Hält sich die Schweiz nicht an die EU-Regeln, kann die EU sie sanktionieren. Das alles ist neu und heikel. Dabei wäre andernorts mehr Handlungsbedarf vorhanden.
(c) 2017: Lugano, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Dieser Integrationsvertrag ändert zu viel.
Mit der Paket-Annahme würden 4388 Seiten EU-Gesetze direkt in der Schweiz gelten. Ohne Mitbestimmung. Die Verordnungen im Umfang von 86% gelten direkt ohne Abbildung in einem Schweizer Gesetz. Die Richtlinien werden mechanisch und direkt ins CH-Recht übersetzt.
(c) 2016: Schartihöreli, Kanton Uri, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Schweizsicht.
Die Sterne stehen für Tragweite, doch die Entscheidung fällt hier. Mit dem Paket Schweiz-EU steht unser Land vor einer existenziellen Zäsur. EU-Gesetze sollen gelten, ohne in einem Schweizer Gesetzbuch zu stehen. Ob wir das wollen, müssen wir selbst beurteilen. Die Regierung möchte es tun. Wir empfehlen es nicht. Die folgende Artikelserie liefert Ihnen die Begründung.
(c) 2017: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Die Schweiz in der Wachstumsfalle. Warum mehr vom Gleichen nicht reicht.
Das BIP pro Kopf hat sich seit 2006 nahezu verdoppelt, in den letzten zehn Jahren stagnierte aber das verfügbare Einkommen pro Kopf. Der Wohlstand der Schweiz wächst nicht im Portemonnaie der Menschen. Das ist nicht zukunftsfähig.
(c) 2016: Morcote, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Was Sie sagen müssten, wenn Sie Bundesrat wären.
Mit dem Paket Schweiz-EU will Brüssel gleiche Regeln für alle. Wenn Sie Bundesrat wären, müssten Sie erklären, dass dies für die Schweiz zwar Marktzugang und planbare Kooperation bringt, aber auch Rechtsübernahme ohne Mitbestimmung. Ihnen wird klar: Das ist eine Zäsur mit Folgen für Demokratie und Wohlstand.
(c) 2019: Monte Boglia, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Freizügigkeit ohne Kompass.
Die Schweiz funktioniert. Sehr gut sogar. Warum funktioniert das Paket Schweiz-EU aus unserer Sicht nicht überzeugend? Wir sagen: Erst das Ziel, dann die Regeln.
(c) 2023: Lago di Lugano, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Die Schweiz. Eine Utopie für Europa?
Mit dem Paket Schweiz-EU schlägt der Bundesrat einen Weg ein, der langfristig zur Anpassung ans europäische Mittelmass führen könnte. Dabei wäre das Gegenteil sinnvoll. Nicht die Schweiz sollte sich der EU angleichen. Europa sollte sich ein Beispiel an der Schweiz nehmen.
(c) 2023: Luganese, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Das Stromabkommen. Passt die Lösung zum Problem?
Das Stromabkommen aus dem Paket Schweiz-EU stellt Importgarantie und Souveränität zueinander ins Spannungsfeld. Nach der institutionellen Betrachtung prüfen wir, wie es aus Bürgersicht inhaltlich abschneidet. In unserem Fazit fragen wir uns, wie so eine Vorlage entstehen konnte.
(c) 2017: Lisone, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Maurizio Vogrig
Dieses Paket bricht mit der direkten Demokratie.
Das Paket Schweiz-EU stellt die direkte Demokratie der Schweiz in Frage. Nach dem EWR-Nein und dem Abbruch des Rahmenabkommens soll mit dem Paket Schweiz-EU jetzt alles anders sein. Wir sehen das nicht so und sagen: Es reicht! Und wir erklären, warum.
(c) 2015: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Paket Schweiz-EU: Time-out bitte.
Die Vernehmlassung zum Paket Schweiz–EU ist angelaufen. Ein positives Zeichen, denn die Diskussionen sind engagiert und erzeugen Resonanz. Die institutionelle Anbindung rückt ins Zentrum der Auseinandersetzungen. Eine Klärung würde der Vernehmlassung gut tun. Der vorliegende Artikel liefert den Anstoss dazu.
(c) 2013: Monte Generoso, Capolage, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Dieses Paket zerreisst nicht nur die FDP. Es zerlegt die Schweiz.
Das Paket Schweiz-EU würde unser Land grundlegend und unwiderruflich verändern. Es geht um die Frage wer künftig unser Recht bestimmt, Brüssel oder wir. Zum 1. August 2025 mein Appell: Mischen Sie sich ein. Unsere Heimat gehört den Menschen nicht der Politik. Ein Blick auf die FDP zeigt warum.
(c) 2017: Capanna Monte Bar, Capriasca, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Das Stromabkommen im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit.
Das neue Stromabkommen (Elektrizität) im Spannungsfeld zwischen Integration und Eigenständigkeit ist ein zentrales Element des Pakets Schweiz–EU. Es offenbart im Perspektivenwechsel ein unerwartetes Ausmass an gegenläufigen Erwartungen der Vertragspartner. Wer eintauchen will, dieser Artikel ist die richtige Gelegenheit dazu.
(c) 2019: Alpe Agra, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Orginalwortlaut Stromabkommen - hier online verfügbar.
Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? Wir haben die 163 Seiten des Stromabkommens ordentlich strukturiert und im Originalwortlaut der EU auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Wir leisten damit einen Beitrag zur Lesbarkeit dieses Abkommens. Wir hoffen, dass viele so einen einfacheren Zugang dazu finden und unser Angebot nützlich ist.
Was Leo zu neuen Schlossherren aus Brüssel meint.
Ein umfassendes Paket von Abkommen zur Festigung, Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen der EU zur Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt jetzt auf dem Tisch. Es bildet die Grundlage für eine folgenschwere Entscheidung der Schweiz, die es ernsthaft auszuloten gilt.
(c) 2025, Schloss Wildegg, Möriken-Wildegg, Aargau, Schweiz, Foto: Roland Voser.
Das Paket Schweiz-EU muss nachverhandelt werden.
Hier finden Sie die Stellungnahme von smartmyway zum Paket Schweiz-EU im Rahmen der offiziellen Vernehmlassung.
(c) 2016: Gewittersturm, Cademario, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
smartmyway unterwegs.
(c) 2019: San Salvatore, Kanton Tessin, Schweiz, Foto: Roland Voser
Seit 2018 Chief Editor, Mitbegründer, Verwaltungsrat und Teilhaber von smartmyway, Autor, Coach, Mentor und Berater. Vorher als Geschäftsführer von Media Markt E-Commerce AG, Media Markt Basel AG, Microspot AG sowie in den Geschäftsleitungen von Interdiscount AG und NCR (Schweiz) AG tätig. Heute Digital Business Coach und Schreiberling.
Experte für Digitalisierung, Agile SW-Entwicklung, Digital-Business, Handel, Sales & Marketing, E-Commerce, Strategie, Geschäftsentwicklung, Transformationen, Turn Around, Innovation, Coaching, erneuerbare Energien, Medien, Professional Services, Category Management, Supply Chain Management